Dem Leben Tiefe verleihen: Warum Rationalität keine Ziele generiert und unser Dasein nicht sichert

© Katja Tropoja
Wissenschaftliche Erkenntnis kann uns helfen, Lebenssituationen realistisch einzuschätzen, um anschließend vernunftgeleitete Entscheidungen treffen zu können.
Nur wenn wir deren Sinnhaftigkeit vor uns selbst und unserer Umwelt gegenüber rechtfertigen und begründen können, sind wir auch in der Lage, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Dieses Gefühl der Verantwortung ist Voraussetzung, um etwas in gewünschter Weise zu bewirken. So kommen wir innerhalb des von uns beeinflussbaren Terrains in der Regel gut durchs Leben. Wollen wir aber die eigene Selbstwirksamkeit spüren und dem Leben einen tiefen Sinn und Reichtum verleihen, stoßen wir mit diesem Konzept bald an Grenzen.
Das Leben ist fortlaufende Erneuerung, deshalb erschaffen auch wir uns immer wieder im Lauf des Lebens neu. Das einmal entworfene Bild, das wir von uns selbst haben, ist nicht statisch, sondern verändert sich mit dem Eintritt in neue Lebensabschnitte. Das alte Modell wird brüchig und hohl und kann sogar vorübergehend ganz verschwinden. Alle Wiederbelebungsversuche des Alten bleiben erfolglos, ein klares Ziel ist nicht in Sicht.
Was tun wir, wenn wir nichts finden, womit wir uns in naher Zukunft identifizieren können?
Unsere Gedanken und Gefühle erschaffen unsere Realität
Diese Erkenntnis ist ein erster Schritt in die Veränderung, mit der wir einen dynamischen Prozess in Gang setzen und zugleich wahrnehmen, dass wir etwas bewirken können. Nicht durch Lesen von Fachbüchern und nicht durch Beratungsgespräche, sondern nur durch unsere Gedanken und die Emotionen, die sie auslösen. Was immer wir heute denken und fühlen, werden wir morgen sein.
Die gute Nachricht: Wenn wir keine Vorstellung unseres zukünftigen Selbst haben, sind wir wie ein unbeschriebenes Blatt. Alles ist offen, alles ist möglich. Jetzt heißt es wachsam sein, denn unsere Mitmenschen - deren Spiegel wir sind und umgekehrt - greifen gern zum Malkasten und färben die weiße Leinwand bunt, so dass wir uns gar nicht mehr wiedererkennen. Das kostet Zeit und ist energieraubend.
Jetzt ist es an der Zeit für einen Wunsch:
Wünschen Sie sich Klarheit darüber, was gut und richtig für Sie ist. Vertrauen Sie darauf, dass Sie eine Antwort auf diese Frage erhalten und haben Sie Geduld!
unsere Existenz basiert auf verbundenheit und Veränderung
Alles ist mit allem verbunden, auch wenn wir das nicht immer so empfinden. Das gilt auch für alle Zeitformen: Die Erinnerung ermöglicht uns eine Reise in die Vergangenheit, die Achtsamkeit lässt uns die Beschaffenheit der Gegenwart erahnen und es ist möglich, eine Vision der Zukunft erzeugen, in der wir auf eine unerschöpfliche Quelle von Zeit und Geld zurückgreifen können. Das geht ohne Zeitmaschine, einzig durch die Fähigkeit des Visualisierens.
Kleine Schritte erleichtern uns die Veränderung. Auch diese können schwerfallen, weshalb wir auf jeden einzelnen stolz sein müssen. Ein Grund zum Feiern! Ziele entwickeln sich langsam, reifen in uns und sind nicht einfach plötzlich da. Je mehr sie sich im Lauf der Zeit konkretisieren lassen, desto näher sind wir ihnen.
Denken Sie daran, wie es sein wird, Ihr Ziel erreicht zu haben, träumen Sie und genießen Sie die malerische Schönheit dieser Szene!
Wann ist das Erreichen eines Ziels sinnvoll ?
faszination ist sinnstiftend
Wir können uns innerhalb einer Gruppe oder Interessengemeinschaft auf den gemeinsamen Nutzen eines Projektes einigen oder auch darauf, dass ein Ziel einen bestimmten - monetären oder ideellen - Wert hat, aber eine Perspektive für die Zukunft können wir immer nur für uns selbst visualisieren. Es entsteht niemals bei zwei Menschen ein identisches Bild, denn Utopien sind individuell.
Sinn macht für uns ein Ziel vor allem dann, wenn wir von der Vorstellung, es erreicht zu haben, fasziniert sind und unsere Leidenschaft dafür entfacht ist. Das passiert vor allem auf emotionaler Ebene und ist nicht allein Ergebnis rationalen Vernunftdenkens.
Warum sollten wir ein Ziel erreichen wollen?
Ziele müssen nicht erreicht werden
Ziele erreichen wir, weil wir es wollen, nicht weil wir es müssen. Wer weiß, warum ein Ziel von großer Relevanz ist, der gewinnt Klarheit über die Werte, die ihm wichtig sind. Zur Faszination gesellt sich deshalb zusätzlich die Motivation.
Wir brauchen starke innere Bilder. Empathie lässt uns Erfahrungen lieben, die uns tief im Innersten berühren und begeistern. So entstehen neue Räume, die wir mit Leben füllen können. Ein flexibles, aber dennoch stabiles Selbstkonzept und Selbstreflexion lassen Ziele sich entwickeln, an denen wir "feilen", bis ihre Früchte erntereif sind.
Wir finden immer wieder neue Wege der Sinnstiftung in scheinbarer Sinn- und Ziellosigkeit - ein Zustand großer geistiger Klarheit im Innen und Außen.
© Katja Tropoja
Die Betrachtung der Welt als Wille und das moralische Bewusstsein

© Katja Tropoja
Schopenhauer hielt im Sommersemester 1820 an der Universität Berlin Vorlesungen über „Die gesamte Philosophie oder die Lehre vom Wesen der Welt“. Sie wurden erstmals erst 1913 vollständig
transkribiert.
Dr. Daniel Schubbe, u. a. Vorstandsmitglied der Schopenhauer-Gesellschaft, hat sie 2017 herausgegeben. Grundlage der folgenden Ausführungen bildet Teil IV, die „Metaphysik der Sitten“. Immer
wieder kommt Schopenhauer in allen Teilen auf die Tatsache des moralischen Bewusstseins zurück.
Unser Mitgefühl macht unser Handeln ethisch bedeutsam
Motiv für moralisches Handeln ist, wozu uns die Empathie befähigt:
Das Mitgefühl und keineswegs unsere Vernunft, Einsicht oder sogar Überzeugung. Wenn der Andere in eine auf Anteilnahme gegründete gemeinsame Geschichte eingebunden ist, dann ist es Mitleid, das
uns Verbundenheit, Hochachtung und Sympathie empfinden lässt. Die wohl beglückendste Erkenntnis dabei ist, dass wir das Wohl eines Anderen ebenso erfolgreich bewirken und fördern können wie unser
eigenes. Wenn wir dafür Verzicht üben müssen, dann mischt sich unserem Leiden Freude bei, die sogar auch dann noch anhält, wenn unser damit verbundener Schmerz längst vergangen ist. Das ist eine
positive Erfahrung. Es gibt viele Andere und zahlreiche Geschichten, die wir miteinander teilen. Deshalb gibt es viele Gelegenheiten, diese Freude zu erfahren, wenn wir uns darauf einlassen.
Der Charakter bestimmt das Verhalten bei gegebenen Motiven
„Die Tugend, die Menschenliebe, der Edelmut gehen aus von dem unmittelbaren und anschaulichen Wiedererkennen des eigenen Wesens in der fremden Erscheinung."
Erst im Lauf des Lebens können wir unseren Charakter erkennen, denn erst die Erfahrung zeigt, was wir wollen und können. Der empirische Charakter zeigt sich in einzelnen Handlungen, bleibt immer gleich und legt fest, wer jemand ist. Ihm geben wir letztlich immer nach. Was sich ändert, ist die Meinung über unsere Handlungen, die sich rückblickend als falsch erwiesen haben, nicht jedoch wir selbst und auch nicht das
handlungsauslösende Motiv in der Vergangenheit. Wir hatten gute Gründe für unser Handeln, oft mangels der für uns erkennbaren Alternativen.
Für diese Erfahrung der eigenen Tugendhaftigkeit brauchen wir immer den Anderen. Sobald wir intuitiv erkennen, dass auch er Teil des gemeinsamen Wesens ist, wird uns unmittelbar bewusst, dass die Existenz aller Individuen letztlich eine leidvolle Dimension besitzt. Die Verbindung über das gemeinsam empfundene Leiden überwindet alle Gegensätze und Distanzen und bleibt für alle zukünftigen zwischenmenschlichen Erfahrungen jederzeit wieder abrufbar und handlungsbestimmend.
Wille oder Vorstellung - wir erfahren beides
„Ist diese Welt nichts weiter als eine Vorstellung, d. h. ein wesenloser Traum, ein gespensterhaftes Luftgebilde, das an uns vorüberzieht? Oder ist sie etwas Anderes, noch etwas außerdem und was ist sie dann… ?“
Bewusstsein ist vorhanden, wo wir das Gegenwärtige wahrnehmen und Vergangenes erinnern. Beides ist nur aus der Erfahrung unseres Körpers, der im Raum in Erscheinung tritt, möglich. Uns selbst und die Welt, die uns umgibt, erfahren wir somit sowohl als Vorstellung, als auch als Wille. Beides existiert in unserer Vorstellung und ist doch eine Erscheinung unseres Willens. Während wir für die Erfahrung der Vorstellung die Koordinaten von Raum und Zeit brauchen, kommt der Wille ohne diese einschränkenden Parameter aus. Er genießt die Freiheit der Vielheit des Möglichen und kennt keine Notwendigkeiten. Außerdem braucht der Willensdrang kein Motiv, denn Motive ändern nur Art und Richtung des Willens, nicht den Willen selbst.
Folgt man Schopenhauer, dann ist das Wesen des Menschen sein Wille. Die Sorge für die eigene Erhaltung, der Fortpflanzungstrieb und die Flucht vor Gefahr sind die drei Grundäußerungen des Willens zum Leben. Dieser hat Vorrang vor dem Intellekt und bejaht sich selbst. Von ihm hängt alles ab, weil der Mensch letztlich immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen ist und sein Wille alles ist, was ihm tatsächlich bleibt. So ist auch das Dasein der Welt relativ, weil abhängig vom freien Willen:
„Der Wille des Menschen bejaht fortdauernd das Leben. Als Spiegel oder Ausdruck dieser Bejahung steht die Welt da, mit unzähligen Individuen, in endloser Zeit und endlosem Raum und endlosen Leiden, zwischen Zeugung und Tod, ohne Ende. … Der Wille führt das große Trauer- und Lustspiel auf eigene Kosten auf und ist auch sein eigener Zuschauer.“
Alles Leben ist Leiden durch Die Erscheinung des eigenen Willens im eigenen und im fremden Körper
"Wir selbst sind der Wille zum Leben. Daher müssen wir leben, gut oder schlecht!“
Der Wille zum Leben strebt in erster Linie nach Selbsterhaltung. Schopenhauer nennt als weitere Erscheinungsformen die Zeugung neuen Lebens und das Unrecht, d. h. der Einbruch in die Grenze fremder Willensbejahung durch Gewalt oder List. Unrecht tut, wer das fremde Individuum zwingt, dem eigenen Willen zu dienen, bzw. nach dem eigenen Willen zu handeln. Der Unrecht-Leidende fühlt den Einbruch in die Sphäre der Bejahung seines eigenen Leibes als einen unmittelbaren und geistigen Schmerz, getrennt vom empfundenen physischen Leiden durch die Tat oder vom Verdruss durch den Verlust. Der Unrecht-Ausübende fühlt den Schmerz und erkennt die ethische Bedeutung seines Handelns, weil sich sein Gewissen meldet. Die Erkenntnis, dass unser Wille in einem fremden Körper erscheint, löst Angst und Entsetzen aus. Wir erschrecken über die Heftigkeit unseres Willens und was er bewirken kann und gewinnen in diesem Zustand schonungslose Erkenntnis über uns selbst.
Resignation, Entsagung und Askese sind Wege aus der Bedeutungslosigkeit
„Glücklich und weise ist, wer viel erkennt und wenig will.“
Neben der Willensbejahung ist die Willensverneinung in Form von Resignation, Entsagung und Askese eine Strategie, mit der Leidensnatur des Lebens umzugehen. Ausgangspunkt ist unser Bewusstsein von der Bedeutungslosigkeit, bzw. dem Bedeutungsverlust der Welt, die so oder anders gewollt sein kann oder eben auch nicht. In diesem Bewusstseinszustand schenkt uns die Resignation Zufriedenheit, indem sie den Willen vorübergehend oder auch für immer stilllegt. Sie ist das einzige radikale Heilmittel, gegen die alle anderen Güter, alle erfüllten Wünsche und alles erlangte Glück nur „Palliativmittel“ sind, wie Schopenhauer sie nennt. Der Resignierende erkennt sein eigenes Wesen und dessen Wirkung in allem und auf alles. Die Handlung und das Erleiden, die Verursachung und das Erdulden, Aktivität und Passivität sind vereint im einzelnen Individuum. Er erkennt, dass sein Wille das Wesen dieser Welt ist, mit all ihren Erscheinungsformen. Der fortlaufende Ausdruck seines Willens in seinen Handlungen und die unbedingte Bejahung des Lebens verbinden ihn unwillkürlich mit der Welt. Sein eigenes Leiden ist nur beispielhaft für das Leiden der Welt insgesamt. In der freiwilligen Entsagung wendet der Resignierende den Willen vom Leben ab. Das Ergebnis ist wahre Gelassenheit in einem Zustand vollständiger Willenlosigkeit. Obwohl den Asketen Seelenkämpfe, Anfechtungen und Verlassenheit begleiten, hat sein Leiden eine reinigende Kraft, die die Verneinung des Willens zum Leben bewirkt.
Andernfalls weicht der Schmerz niemals ganz und wir hoffen, in der Suche nach einer äußeren, einzelnen Ursache des Leidens, Linderung zu finden. Jede Bedürfnisbefriedigung erzeugt aber neue Wünsche und ist der Anfangspunkt eines neuen Strebens, das vielfach durch äußere Bedingungen gehemmt ist und sich überall und permanent in einem Kampf befindet, der für wirkliche Reflexion und Erkenntnis keinen Raum mehr bietet.
Glück ist die Abwesenheit des Leidens
„Jeder Wunsch entspringt einem Leiden, jede Befriedigung ist hinweg genommener Schmerz.“
Das höchste Gut und größte Glück des Menschen scheint die völlige Schmerzlosigkeit zu sein. Doch schon Epikur erkannte, dass aller Genuss von negativer Natur ist, weil er in der Beseitigung eines Schmerzes oder Unbehagens sein Wesen hat. Befriedigung und Genuss können wir nur durch Erinnerung an das vorangegangene Leiden und Entbehren erfahren, also stets mittelbar. Alle Güter und Vorteile beglücken nur, indem sie das Leiden abhalten oder ihm ein Ende bereiten. Das Maß des Notwendigen wächst mit zunehmendem Besitz, dessen Abwesenheit als schmerzhafter Mangel empfunden wird. Die Erkenntnis, dass alles Erlangte niemals leistet, was das Begehrte versprach, lässt auf die Erlösung von Mangel und Schmerz stets ein neues Leiden folgen. Durch die Wunscherfüllung ändert der Wunsch nur seine Gestalt und das Leiden beginnt von Neuem. Noch bitterer ist folgende Erkenntnis: Wenn wir durch den Genuss, den wir uns selbst verschaffen, nichts anderes tun, als uns von Leiden zu befreien, dann können wir auch für Andere nichts weiter tun, als ihre Leiden zu lindern! Das ist eine negative Erfahrung. Es gibt viele Andere und zahlreiche Bedürfnisse, denen wir begegnen können. Deshalb gibt es viele Gelegenheiten, diese Qualen zu erleiden, wenn wir uns darauf einlassen.
Alles Leiden ist unerfülltes und durchkreuztes Wollen
„Das Leben unseres Leibes ist nur ein fortdauernd gehemmtes Streben, ein immer aufgeschobener Tod.“
Das bitterste aller geistigen Leiden ist die Unzufriedenheit mit uns selbst, die gekränkte Eigenliebe, oft als Folge der Unkenntnis der eigenen Individualität. Der Wille ist überall das innerste Wesen des Lebens und das Wesen des Menschen äußert sich im Wollen. Der Mensch vergewissert sich im Wollen seines Daseins. Es ist ein Streben ohne Ziel und Ende. Das gilt für Zeit und Raum sowie für das Leben und Sterben gleichermaßen. Die Bemühungen, das Leiden zu verbannen, führen nur dazu, dass sich dessen Gestalt ändert. Der Schmerz ist dem Leben wesentlich und unausweichbar. Vom Zufall hängt nur seine Gestalt ab.
Für den Willen gibt es nicht das höchste und absolute Gute, sondern immer nur ein einstweiliges und relatives. Die Basis allen Wollens sind Bedürftigkeit, Mangel und Schmerz, während das innerste Wesen der Natur ein Streben ohne Ziel und ohne Befriedigung ist.
Das „Gute“ bezeichnet die Angemessenheit eines Objektes zu irgend einer bestimmten Bestrebung des Willens. Gut ist demnach alles, was dem Willen zusagt und seinen Zweck erfüllt.
Der Tod ist ein mathematischer Punkt
„Wir haben den Tod so wenig zu fürchten wie die Sonne die Nacht.“
Wir müssen den Schmerz des Todes nicht fürchten, denn er liegt diesseits des Todes. Deshalb haben wir bisweilen den Wunsch, vom Schmerz zum Tod hin zu fliehen. Wir nehmen aber auch Schmerzen in Kauf, um dem Tod zu entgehen.
Das Leben ist ein Kampf um die Existenz, mit der Gewissheit, den Kampf zu verlieren. Der Wille zum Leben bedeutet Flucht vor dem Tod, oder zumindest der trügerische Wunsch danach, denn der Tod führt so wenig aus der Welt heraus, wie die Geburt hinein führt.
Stoischer Gleichmut gegenüber Freude und Schmerz
Freude und Schmerz werden durch Antizipation der Zukunft hervorgebracht und bedingen sich wechselseitig. Schopenhauer bezeichnet Jubel und Schmerz als Überspannungen des Gemüts, die einem Irrtum und Wahn zugrunde liegen. Durch größtmögliche Gleichgültigkeit gegen die Dinge, auf der Basis innerer, unmittelbarer und intuitiver Erkenntnis, ließe sich das aber vermeiden. Im Bewusstsein, dass unser gegenwärtiges Leiden eine Stelle ausfüllt, die, wenn dieses nicht da wäre, von einem anderen Leiden eingenommen werden würde, erkennen wir die Nichtigkeit und Bitterkeit des Lebens, die Reinigung und Heiligung ermöglichen. Deshalb kann das Schicksal uns nur wenig anhaben! Im Bewusstsein der Nichtigkeit aller Güter und des Leidens allen Lebens, im Zustand der Willenlosigkeit, zeige sich der Charakter sanft, traurig, edel und resigniert:
„Wenn wir uns als reines, willenloses Subjekt des Erkennens, als Korrelat der Idee, der ästhetischen Betrachtung hingeben, dann schweigt alles Wollen. Diese schweigende Willenlosigkeit ist der Hauptbestandteil der Freude am Schönen.“
Dem reinen Erkennen, dem Genuss des Schönen, der echten Freude an der Kunst, bleibt alles Wollen fremd. Im Zustand der reinen Kontemplation wollen wir nichts. Wir werden stattdessen zum Korrelat der Idee, zum rein erkennenden Wesen, als ungetrübter Spiegel der Welt. Der Wille bindet uns nicht mehr an die Welt. Damit schaffen wir die Grundlage für das, was wir als „joy of grief“ (Wonne der Wehmut) bezeichnen: Der Gram hat keinen bestimmten Gegenstand mehr, sondern verbreitet sich über das Ganze des Lebens und wird begleitet durch eine heimliche Freude. Der Wille verschwindet, das Leiden nimmt die Form reiner Erkenntnis an und führt die wahre Resignation und somit Erlösung herbei.
Davon weit entfernt ist der Selbstmord, der nicht Verneinung des Willens ist, sondern überaus starke Bejahung des Willens zum Leben, wobei das Streben sich nicht entfalten kann. Zerstört wird nicht das Leben, sondern dessen Erscheinung. Weil der Selbstmörder nicht aufhören kann, zu wollen, hört er auf, zu leben.
Erlösung im Machtgefühl über die eigenen Empfindungen
„Das menschliche Gemüt hat Tiefen, Dunkelheiten und Verwicklungen, welche aufzuhellen und zu entfalten, von der äußersten Schwierigkeit ist.“
Wenn wir uns in der fremden Person und in deren Leiden wiedererkennen, entsteht ein Machtgefühl über die eigenen Empfindungen. Unser Vorteil als Mensch besteht darin, dass die Reflexion in uns die Macht über das unmittelbare Gefühl haben kann. Was uns dann bewegt, ist Mitleid, die reinste Form der Liebe, ohne Selbstzweck. Die menschliche Vernunft kann bewirken, dass wir das Ganze sehen und nicht nur das Einzelne. Entsagung und Übung in ästhetischer Beschaulichkeit und Achtsamkeit ermöglichen die Aufhebung des Wollens, die Erlösung durch Freiheit, die Vernichtung jeder von uns konstruierten Welt: Kein Wille, keine Vorstellung, keine Welt, keine Zeit, kein Raum, kein Subjekt, kein Objekt, nur die Erkenntnis bleibt! … “ … und der Frieden, der höher ist als alle Vernunft, eine tiefe Ruhe und gänzliche Meeresstille des Gemüts“ (Schopenhauer).
„Wer das Leben bejaht, kann sich des Lebens gewiss sein. … Dem Willen ist das Leben, dem Leben ist die Gegenwart sicher und gewiss.“
© Katja Tropoja
Tauschkulturgut und Beziehungsgenerator: Warum Geld ein mulitfunktionales, aber inhaltloses Sondergebilde ist
© Katja Tropoja
Die Entdeckung der Ästhetik und der Reiz der Resignation
Geld an sich ist formlos und zunächst ein Produkt unseres Geistes. Zum sichtbaren Körper wird es erst, wenn es im Tauschvorgang einen ökonomischen Wert angenommen hat und eine Beziehung zwischen verschiedenen Objekten hergestellt ist. Das gilt sowohl für Personen, als auch für Gegenstände. In diesem indifferenten Durchgangsstudium des Tausches und der Erzeugung von Wertrelationen haben wir eine Chance, die Ästhetik des Geldes als Äquivalent der Dinge zu finden und auch selbst zu gestalten.
Subjektiv freuen können wir uns über Geld aufgrund seiner Abstraktheit und Absolutheit nicht. Auch der Antizipation von Zukünftigem erweist es keinen Dienst, denn dieser Vorgang verlangt
ebenfalls Subjektivität. Es verschafft uns aber das, was G. Simmel den „Reiz der Resignation“ nennt, der nur aus objektiver Freude auf das, wozu uns Geld in der Zukunft verhilft, entstehen kann.
Diffuse Ungewissheit impliziert stets die Grenzenlosigkeit unserer Visionen, Möglichkeiten und geplanter Endzwecke in einer objektiven Gegenwart. Ob unser gegenwärtiger Besitz tatsächlich in
Zukunft von hohem Wert sein wird, ist ungewiss.
Mit Geld lässt sich nahezu alles objektiv messen und kategorisieren:
„Im Geld hat der Wert der Dinge seinen reinsten Ausdruck und Gipfel gefunden."
(Georg Simmel in: Die
Philosophie des Geldes)
Distanz, Verbundenheit und bedingungslose Fungibilität
Obwohl Geld selbst keinen Inhalt hat, erfüllt seine Existenz einen Sinn. Es besitzt Gültigkeit und Wirksamkeit zu jedem Zeitpunkt, denn es gewährleistet unbedingte Fungibilität, d. h. mengen- und wertmäßige Bestimmbarkeit und Austauschbarkeit von wirtschaftlich relevanten Objekten, auch von Personen. So wird es zugleich Symbol und Ursache für den absoluten Bewegungscharakter der Welt, für elementare Vergleichgültigung, Veräußerlichung und wechselseitige Abhängigkeiten.
Die Geldhaftigkeit der Beziehungen erzeugt einerseits Distanz zwischen Menschen, die vor zu viel Nähe und Reibung schützt. Geld schenkt uns Abstraktheit und Freiheit von Rücksichtnahme auf Dinge und von Unmittelbarkeit der Beziehung zu ihnen. Es stellt ein Gleichgewicht her zwischen Annäherung, Berührung, Schwingung und Stillstand.
Zwischen Menschen und deren Interessen schafft Geld andererseits die notwendige Verbindung und die gemeinsame Basis. Es schafft ein gemeinsames, zentrales Interesse und wird selbst zum Zweck erhoben. Geld prägt die objektive Kultur, alle zwischenmenschlichen Beziehungen und unsere materialisierten Lebensinhalte. Auch Aufmerksamkeit, Zustimmung, Zuneigung und Wohlwollen kann man kaufen und verkaufen.
„Wo nur immer viele Menschen zusammenkommen, wird Geld verhältnismäßig stärker erfordert werden. Denn wegen seiner an sich indifferenten Natur ist es die
geeignetste Brücke und Verständigungsmittel zwischen vielen und verschiedenen Persönlichkeiten; je mehr es sind, desto spärlicher werden die Gebiete, auf denen andere als Geldinteressen die Basis
ihres Verkehrs bilden können."
(Georg Simmel in: Die Philosophie des Geldes)
Dynamik, Kondensiertheit und Rundheit des Geldes
Geld erfüllt seine Funktionen, indem wir es weitergeben und -bewegen. Es entäußert sich permanent selbst. Seit dem beginnenden Kapitalismus stellt auch die Zeit einen Wert dar. Brauchbarkeit und
Knappheit bestimmen dessen Höhe. Damit einher geht seit dem
15. Jahrhundert ein Kondensierungsprozess, der Werte zunächst in die Geldform und diese später in die Börsenform transformierte. Zuvor eckige Münzen wurden rund gefertigt, im 18. Jahrhundert gab
es z. B. sog. Kugelgeld in Ägypten und mit steigender Geldwirtschaft ging man dazu über, ganze Geldsummen „abzurunden“.
Die Rundheit symbolisiert die Bewegungsdynamik, die das Geld dem Geldverkehr verleiht. Es zirkuliert immer schneller im eingangs erwähnten Tauschvorgang und auch in den Beziehungen zwischen Objekten, denen so der reine Geldcharakter verliehen wird.
Diese Beschleunigungstendenzen nahm G. Simmel bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wahr:
„In der Wirklichkeit dauern die Dinge überhaupt keine Zeit, durch die Rastlosigkeit, mit der sie sich in jedem Moment der Anwendung eines Gesetzes darbieten, wird jede Form schon im Augenblick ihres Entstehens wieder aufgelöst, sie lebt sozusagen nur in ihrem Zerstörtwerden, jede Verfestigung zu dauernden Dingen ist eine unvollkommene Auffassung, die den Bewegungen der Wirklichkeit nicht in deren eigenem Tempo zu folgen vermag. So ist es das schlechthin Dauernde und das schlechthin Nicht-Dauernde, in die und deren Einheit das Ganze ohne Rest aufgeht.“
(Georg Simmel in: Die Philosophie des Geldes)
Die Vorläufigkeit unserer Ziele macht sie zu neuen Mitteln
Unser Bewusstsein ist nur beschränkt aufnahmefähig, deshalb nutzen wir es kräfteschonend und möglichst zweckorientiert. Nur wenige Facetten eines Objektes unseres Interesses finden unsere Beachtung. Simmel empfiehlt, alle Kraft auf das zu konzentrieren, was unmittelbar und kurzfristig notwendig ist:
„Dadurch, dass der Endzweck immer im Bewusstsein ist, wird eine bestimme Summe von Kraft verbraucht, die der Arbeit an den Mitteln entzogen wird. Das praktisch Zweckmäßigste ist also die volle Konzentration unserer Energien auf die nächst zu verwirklichende Stufe der Zweckreihe; d. h. man kann für den Endzweck nichts Besseres tun, als das Mittel zu ihm so zu behandeln, als wäre es er selbst.“
(Georg Simmel in: Die Philosophie des Geldes)
Zynismus und Blasiertheit der Geldkultur
Beide sind Ergebnis der Reduktion „höherer Werte“ auf den Mittelwert des Geldes und auf beiden gründen sich Geiz und Geldgier. Der antike Zynismus hatte zunächst ein positives Lebensideal: Die unbedingte Seelenstärke und sittliche Freiheit des Individuums. Diesen Werten ordnet der Zyniker alle anderen Werte unter. Sie sind ihm gleichgültig. An dieser Stelle hat Geld die Funktion, die höchsten wie die niedrigsten Werte gleichmäßig auf eine Wertform zu reduzieren und sie auf dasselbe prinzipielle Niveau zu bringen. Der Blasierte fühlt alle Dinge in einer gleichmäßig matten und grauen Tönung. Er besitzt eine Indifferenz gegenüber den Dingen, bzw. ihrer Unterschiedlichkeit, weil allzu starke Reize alle Reaktionsfähigkeit aus den Nerven herauspumpen.
Die Befangenheit des Lebens in seinen Mitteln
Ist Geld Ausdruck und Aquivalent aller Werte? Ist es Zentrum aller Gegensätzlichkeiten? Besitzt Geld Allmacht? Sicher nicht, aber es symbolisiert am deutlichsten die Relativität der Dinge und das Befangensein des Lebens in seinen Mitteln. Geiz und Geldgier basieren auf dieser zweckhaften Eigenschaft des Geldes.
Wir können uns am Geld erfreuen, ohne es zu begehren, denn es ist unabhängig von unserer subjektiven Bewertung und zunächst auch frei von den dargestellten Zweckeigenschaften.
Dinge, die einen konstanten Wert haben – wie z. B. die Schönheit, die Ordnung und Bedeutsamkeit des Universums, etc. – bedürfen nicht des Konsums und sie sind zeitlos. Fragen nach Sinnhaftigkeit, Brauchbarkeit und Knappheit spielen bei konstanten Werten keine Rolle. Dennoch entdecken wir in ihnen die Ästhetik und können uns subjektiv an ihnen erfreuen. Konstante Werte genügen sich selbst. Nur unser Blickwinkel entscheidet, was Mittel und was Zweck sein soll. Die Kunst stellt so einen konstanten Wert und die typisch-allgemeinen Züge der Erscheinungen dar. Sie appelliert an die typischen Seelenregungen in uns : „Es ist der ganze Sinn der Kunst, aus einem zufälligen Bruchstück der Wirklichkeit eine in sich ruhende Totalität, einen Mikrokosmos zu gestalten.“ (G. Simmel in: Die Philosophie des Geldes).
„Die Kunst gründet ihren prinzipiellen Anspruch auf allgemeine subjektive Anerkennung, auf die Ausschaltung alles Zufällig-Individuellen in ihrem Objekt.
Alle Kunst verändert die Blickweite, in die wir uns ursprünglich und natürlich zur Wirklichkeit stellen. Jede Kunst stiftet eine Entfernung von der Unmittelbarkeit der
Dinge.
(Georg Simmel in: Die Philosophie des Geldes)
© Katja Tropoja
Warum wir denken und was letztlich unser Erkennen bestimmt: Der Raum der Wünsche, die Wahrheit der Welt und die Deutbarkeit von Vergangenheit
© Katja Tropoja
Die Philosphie setzt prämissenloses Denken voraus
Unser Denken kann ohne Prämissen auskommen, unser Erkennen jedoch nicht. Darüber hinaus ist der Prozess des Erkennens nicht voraussagbar und er findet keinen Abschluss. Er ist stattdessen stets fragmentarisch, diskontinuierlich und stark abhängig von weiteren Parametern. Die Darstellung und Untersuchung dieser Prämissen des Erkennens obliegt der Philosophie, die aber nur durch prämissenloses Denken möglich ist.
Der Eintritt in einen Raum der Wünsche und Möglichkeiten setzt gedachte Distanz voraus
Letztlich denken wir nach, weil wir auf der Suche nach uns selbst sind, denn Verlässlichkeit, Substanz und Absolutheit finden wir in erster Linie dort, nicht im Außen. Wenn wir unser Denken auf uns selbst fixieren und unser Leben nach uns selbst ausrichten, dann sind wir uns selbst genug und erst dann sind wir zu bedingungsloser Liebe fähig.
Alles, was objekthaft außerhalb von uns ist, kann nützlich und schön sein, ist aber letztlich nicht von Bedeutung. Eine Beziehung dazu bringt uns unserem Selbst nicht näher: „Am Objekt erlahmt unsere Freiheit“ - sagt Georg Simmel, weil wir es nicht assimilieren können. Es bleibt in seinem Sein unberührt. Es ist der Zustand der Befriedigung, der erstrebenswert ist, nicht das sachlich bedeutsame Objekt an sich:
„Erst der Aufschub der Befriedigung durch das Hindernis, die Besorgnis, das Objekt könne einem entgehen, bringt die Intensität des Wollens und die Kontinuität des Erwerbens.“
(Georg Simmel in: Die Philosophie des Geldes)
Von Bedeutung sind demnach der Entzug sowie die Distanz zwischen Wunsch und Wunscherfüllung, die Ergebnis des Denkens ist, nicht das Objekt selbst. Nur aus dieser gedachten Distanz kann ein Raum entstehen und dieser Raum heißt Möglichkeit. Er liegt stets in der Zukunft. Trotzdem können wir uns in der Gegenwart in ihm aufhalten. Die Distanz ist somit keine räumliche, sondern eine zeitliche, denn wir können den Raum der Möglichkeiten jederzeit betreten und auch immer wieder verlassen.
Die „Wahrheit“ der Welt ist ein Ergebnis unseres Denkens
Während wir das Objekt sinnlich erfassen und dabei Freude empfinden, gibt es sich uns hin. In der ästhetischen Freude hingegen bleibt das Objekt passiv, denn wir geben uns dem Objekt hin. Genuss und Nutzen scheinen dafür die Voraussetzung zu sein, ebenso Sinnhaftigkeit und Harmonie. Besonders attraktiv erscheint uns, was symmetrisch, ausgeglichen und ebenmäßig ist, was sich um ein Zentrum herum an- und einordnen lässt. Auch die Natur fordert Symmetrie, nämlich die der Seele. In der Natur der Seele liegt es wiederum, Unterschiedlichkeit zu schaffen, wo sich Gleiches bereits etabliert hat. Die Seele resultiert aus dem Zustand der Welt, deren „Wahrheit“ ein Produkt unserer Vorstellungen und das Ergebnis unserer Seelenarbeit ist. Dieses Weltbild „schwebt in der Luft“, wie G. Simmel sagt und ist „für niemanden ein Spiegelbild der Dinge an sich“. Was wir als Wahrheit bezeichnen, resultiert aus den wechselseitigen Beziehungen in einem Raum, der die Produkte unserer Imagination und Suggestionen beherbergt.
Das Denken ist die fundamentale Leistung unseres Geistes und die Bewusstseinsarbeit ist die bedeutsamste und folgenreichste unter den historischen Kategorien der Menschheit. Erst die durch Denken erzeugte Vergegenständlichung des Geistes schenkt dem Menschen (s)eine Welt.
Die Deutbarkeit von Ereignissen setzt Gegenwart und Vergangenheit gleichermaßen voraus
Nur aus der Erfahrung unmittelbarer Gegenwart heraus ist die Vergangenheit deutbar und lebendig. Die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit und umgekehrt gilt: Nur die Vergangenheit lässt uns die Gegenwart begreifen – eine ruhelose Gegenseitigkeit der Deutungselemente:
„Wenn wir historisch denken, so ist die Sele mit all ihren Formen und Inhalten ein Produkt der Welt - eben dieser Welt, die doch, weil sie eine vorgestellte ist, zugleich ein Produkt der Seele ist.“
(Georg Simmel in: Die Philosophie des Geldes)
Alle Formen und Dinge sind das Ergebnis vergangener Ereignisse, die so viel Kraft hatten, unsere Gegenwart und unser Denken zu beeinflussen:
„Wenn ein Gegenstand uns in der Vergangenheit Freude bereitet hat, dann reicht in der Gegenwart der bloße Anblick oder auch nur die bildhafte Erinnerung daran, um ein Glücksgefühl hervorzurufen. Seine erneute Konsumption ist dafür nicht mehr notwendig.“
(Georg Simmel in: Die Philosophie des Geldes)
© Katja Tropoja
In der selbstgenügsamen Distanz zum Objekt gestalten wir eine stabile Wertewelt
© Katja Tropoja
Über allen Werten stehen die Ideen
Der Platonschen Ideenlehre folgend, liefern uns die Ideen den Inhalt unseres Lebens, innerhalb unserer individuellen Wertewelt und Wirklichkeit. Das umfasst alles, wofür wir einen Begriff suchen
und finden können, dem wir einen Namen geben können und was irgendeine Art von Qualität hat.
Das Hauptmerkmal unserer ideenhaften Vorstellungen ist dabei die Subjektivität, denn indem wir bewerten, urteilen wir stets subjektiv über ein bestimmtes Attribut einer Sache und deren Bedeutung
für uns. Ohne Begriffe gibt es keine Ideen und ohne Ideen keine Werte. Quantität und Qualität von Werten und deren Veränderung verleihen dem Leben Tiefe und bestimmen dessen subjektiv empfundenes
Tempo.
Die Begehrtheit bedingt den Wert als metaphysische Kategorie
„Indem wir begehren, was wir noch nicht haben und genießen, tritt dessen Inhalt uns gegenüber. (…) Der Inhalt wird Gegenstand, sobald er uns entgegensteht, (…) in der Distanz des Nochnichtgenießens, deren subjektive Seite das Begehren ist.“, schreibt Georg Simmel 1900 in einem seiner Hauptwerke „Die Philosophie des Geldes“. Das Begehren sei die erste Stufe der Annäherung, die erste ideelle Beziehung zu ihm. Mit der Distanz wachse die Annäherung.
Ob uns eine Sache begehrensWERT erscheint, hängt nicht allein davon ab, ob sie brauchbar ist und SeltenheitsWERT besitzt, sondern in erster Linie von den Gefühlen, die sie in uns auslöst. Emotionen bestimmen unser Denken und Handeln. Aber sind sie tatsächlich notwendig, um einer Sache Sinn zu verleihen?
Nicht das Objekt an sich löst unmittelbar einen wie auch immer gestalteten Affekt bei uns aus, sondern seine Bedeutsamkeit für uns, seine Seltenheit, seine Ersetzbarkeit, die Schwierigkeiten und Hindernisse, die zu seiner Erlangung überwunden werden müssen, seine (räumliche) Entfernung von uns, die Geduld, die wir aufbringen müssen oder die Option, etwas endgültig zu verlieren, ganz darauf verzichten und aufgeben zu müssen und letztendlich enttäuscht zu scheitern. Das Objekt an sich hat zunächst gar keinen Wert. Bedeutung hat erst, was von Unsicherheit des Fortbestands und der Erreichbarkeit gekennzeichnet ist.
Wir konsumieren den Wert eines Objektes im Zustand dessen Genusses, mit Überwindung aller Hindernisse, die uns von ihm trennten. Neu entstehen kann er erst mit der Distanz.
Werte stehen außerhalb des Dualismus von Subjekt und Objekt und sie sind nicht darauf angewiesen, anerkannt zu sein, sie sind metaphysischer Natur, denn:
Auch wenn ein Wert keine Anerkennung erfährt, büßt er damit nichts von seinem Wesen ein!
Die Seele wohnt in unserer individuellen Wertewelt
Wenn wir ein Objekt gegen ein anderes eintauschen, haben wir die unmittelbarste und direkteste Verbindung zur Welt der Werte. Wir setzen einen Wert ein, um einen anderen zu erhalten, verzichten auf etwas, um im Gegenzug zu erhalten, was wir als gleich- oder höherwertig ansehen. Im Tausch erkennen wir am deutlichsten, was uns und anderen Menschen wichtig ist. So schaffen wir Klarheit, Übereinstimmung und Verständigung in der Kommunikation in allen Lebensbereichen, nicht nur in der Ökonomie:
„Die Wirtschaft leitet den Strom der Wertungen durch die Form des Tausches hindurch, gleichsam ein Zwischenreich schaffend zwischen den Begehrungen, aus denen alle Bewegung der Menschenwelt quillt, und der Befriedigung des Genusses, in der sie mündet.“
(Georg Simmel in: „Die Philosophie des Geldes“).
Außerhalb dieser Tauschhandlungen bleiben unsere Werte mehr oder weniger unkonkret und abstrakt, obwohl sie uns während unseres ganzen Lebens begleiten. Oftmals ohne es bewusst wahrzunehmen, stellen wir permanent irgend etwas mit ihnen an: Wir wiegen sie gegeneinander auf, erstellen eine Rangliste, drängen sie anderen Menschen auf. Wir errichten ein Gebäude aus Werten, in dem wir uns zuhause fühlen dürfen. Schließlich zeichnen wir mit Wertvorstellungen unser buntes Bild von der Welt. Dabei machen Kontrast und Vielfalt unsere Wertewelt komplett: Der Wechsel in der Wertigkeit, aber auch die Beständigkeit in dem, was wir gewohnt sind und was uns vertraut ist.
Begreifbarkeit statt Greifbarkeit
Erst in der Selbstgenügsamkeit, im Zurückziehen in uns selbst, schaffen wir eine Verbindung zu den Dingen. Nur aus dieser Verbindung heraus können wir von ihnen abrücken und uns distanzieren. Das Uneinssein mit ihnen und das Nicht-Besitzergreifen müssen wir akzeptieren, denn ohne Distanz haben wir keinen Überblick, ohne Verallgemeinerung erkennen wir nicht die Details. Nur aus der Entfernung heraus kann uns das, was sich uns aus der Nähe heraus betrachtet diffus begehrenswert, merkwürdig bedeutsam, unruhig und ungeordnet präsentiert, nicht mehr den Blick verklären. Diese - oft schmerzhafte - Distanz schafft jedoch den Raum, in dem beständige Werte entstehen können. In dieser Welt konsumieren wir nicht, müssen nicht besitzen, um uns vollständig zu fühlen. Nur weil wir uns selbst genügen, verlieren Objekte nicht an Wert, sondern im Gegenteil: In dieser Wertewelt finden wir vollendete Sinnhaftigkeit und die Fähigkeit zu umfassender Erkenntnis aller Wertzusammenhänge.
© Katja Tropoja
Die Einheit der Gesellschaft entsteht durch funktionale Differenzierung ihrer Teilsysteme

© Katja Tropoja
Niklas Luhmann, einer der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, lieferte eine umfangreiche systemtheoretische Gesamtschau sozialer Wirklichkeit. Er analysierte und erforschte vor allem die sozialen Erscheinungsformen der modernen Gesellschaft. „Die Gesellschaft der Gesellschaft“ von 1997 ist das Hauptwerk seiner Gesellschaftstheorie.
Die moderne Gesellschaft ist funktional differenziert
Die moderne Gesellschaft ist eine Kombination verschiedener Teilbereiche. Dazu gehören zum Beispiel die Politik, die Wissenschaft, die Kunst, die Religion, die Wirtschaft, usw. Alle unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Funktionen und Handlungsweisen voneinander, aber alle haben den gleichen Stellenwert. Alles, was sich gesellschaftlich ereignet, steht in einem mehrdimensionalen Kontext dieser Vielzahl von Teilsystemen. Auf jedes einzelne sind wir angewiesen, denn jedes trägt dazu bei, dass die Gesellschaft sich reproduzieren kann. Deshalb gibt es nicht nur eine soziale Wirklichkeit, sondern so viele wie es teilsystemische Sichtweisen gibt. Das meint Luhmann mit gesellschaftlicher Reproduktion. Die Einheit der Gesellschaft ist nichts anderes als diese Differenz der Funktionssysteme; sie ist nichts anderes als deren wechselseitige Autonomie und Unsubstituierbarkeit. Die Leistung eines wegfallenden Teilsystems kann nicht durch die Mehrleistung eines anderen ersetzt werden, denn:
„In funktional differenzierten Gesellschaften gilt (…): das System mit der höchsten Versagensquote dominiert, weil der Ausfall von spezifischen Funktionsbedingungen nirgendwo kompensiert werden kann und überall zu gravierenden Anpassungen zwingt.“
(Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1997)
Gesellschaftliche Teilsysteme sind Geschlossen und Selbstbezogen
Ein gesellschaftliches Ereignis ist erst dann von Bedeutung, wenn es kommuniziert wird. Erst dann treten die Teilsysteme in Beziehung zueinander und kooperieren miteinander, bleiben aber immer klar voneinander abgegrenzt. Sie finden keine gemeinsame Sprache und können deshalb die Intention der anderen Bereiche nicht nachvollziehen. Dennoch sind sie für systemfremde Einflüsse zumindest durchlässig. Dadurch entsteht, was Luhmann strukturelle Kopplungen nennt. Diese sind wiederum eng miteinander vernetzt, was systemintegrative Prozesse überhaupt erst ermöglicht und garantiert. Im Idealfall verhindern diese Kopplungen, dass die Aktivitäten eines gesellschaftlichen Teilsystems in einem anderen negative Wirkung entfalten können.
Sinnentleertheit führt zu inflationärem Anspruchsverhalten
Luhmann geht nicht von einer (Lebens-)Sinnentleerung des modernen Menschen aus, sondern stellt vielmehr fest, dass gar keine Leere entstehen kann. Jedes Vakuum wird durch immer neue Erwartungen an die Teilsysteme ersetzt. Der Mensch als Teil der modernen Gesellschaft beansprucht Leistungen dieser Systeme, zu denen sie sich selbst verpflichtet haben. Er setzt deshalb deren Bringschuld voraus. Luhmann bezeichnet diese Entwicklung als Anspruchsindividualismus, der in Anspruchsinflationen münden kann.
Er sieht einen Zusammenhang zwischen dem, was einerseits der moderne Individualist von gesellschaftlichen Teilsystemen erwartet und dem, was diese andererseits bieten und versprechen:
„Funktionsautonomie und Anspruch verzahnen sich ineinander, begründen sich wechselseitig, steigern sich im Bezug aufeinander und gehen dabei eine Symbiose ein, der gegenüber es keine rationalen Kriterien des richtigen Maßes mehr gibt.“
(Niklas Luhmann: Die gesellschaftliche Differenzierung und das Individuum. 1987).
Die Teilsysteme setzen global auf Wachstumssteigerung, um Verteilungskonflikte zu verhindern. Vor allem in den Bereichen Finanzen und Bildung sind die Grenzen dieses Vorgehens schnell erreicht. Besonders problematisch wird es, wenn behauptet wird, dass Wachstum gar keine Grenzen kennt.
Fehlende Teilhabe löst eine Kettenreaktion aus
Die Exklusivität eines Teilsystems bedeutet in der Regel den Ausschluss bestimmter Personengruppen aus weiteren Teilsystemen, da diese auf vielfache Weise
voneinander abhängen. Wer keinen Zugang zu Bildung hat, hat keinen Zugang zum Arbeits- und Kapitalmarkt, zum Gesundheits- und Freizeitmarkt, zu politischer Teilnahme, usw. Oft findet dann auch
keine räumliche Inklusion statt, was gut an der Ghettobildung in Großstädten abzulesen ist. Teile der Gesellschaft werden damit aus sämtlichen Systemen geworfen. Sie sind nicht mehr im
Spiel.
Luhmanns Lösungsvorschläge
-
Den politisch Verantwortlichen rät Luhmann zu Restriktionen. Seiner Meinung nach solle sich die Politik darauf beschränken, bestehende gesellschaftliche
Auseinandersetzungen zu schlichten und nur über das zu entscheiden, was gesamtgesellschaftlich tatsächlich notwendig ist. Dabei sei auf Verbindlichkeit und Verlässlichkeit zu achten. Jede
Form der Lenkung in eine bestimmte Richtung sei zu vermeiden.
- Darüber hinaus könnte ein völlig neuartiges gesellschaftliches Teilsystem kreiert werden, das zum einen die Inklusion aller Mitglieder einer modernen Gesellschaft gewährleistet und zusätzlich inflationäre Tendenzen in Bezug auf das Anspruchsverhalten und die von den anderen Teilsystemen in Aussicht gestellten Exklusivleistungen korrigiert. Als binären Code dieses innovativen Teilsystems schlägt Luhmann die Begriffe "Nachhaltigkeit“ und „mangelnde Nachhaltigkeit“ vor.
Ein Jahr nach dem Erscheinen seines gesellschaftstheoretischen Hauptwerkes ist Niklas Luhmann verstorben. Seitdem sind zwanzig Jahre vergangen. Eine Umsetzung seiner Lösungsansätze ist nicht erkennbar.
© Katja Tropoja
Kultur und Gesellschaft entwickeln sich aus der Dynamik von Widersprüchen: Wie Interpenetrationsprozesse und Kommunikation die Moderne organisieren

© Katja Tropoja
Der Entwurf immer neuer Modellkonstruktionen mit dem Ziel, einen Idealzustand zu erreichen, ist ein Kind der Aufklärung und vollzieht sich in einem unendlichen und immer wiederkehrenden Prozess. Deshalb sei die Veränderung das Grundprinzip der Moderne, sagt der Soziologe Richard Münch 1996 in dem Artikel „Modernisierung und soziale Integration“ der Schweizerischen Zeitschrift für Soziologie (Nr. 22). Würden wir die Realität - oder das, was wir für „real“ halten - nicht ständig mit dem Bild des von uns gewünschten Soll-Zustands abgleichen, wäre Kommunikation nicht mit der hohen Geschwindigkeit, der großen Reichweite und der Informationsdichte notwendig, mit der sie gegenwärtig stattfindet.
Die Moderne ist in ihrer Dynamik paradox und widersprüchlich
Widersprüche rufen stets Aktivitäten zu deren Abarbeitung hervor. Diese Aktivitäten erzeugen dann wieder neue Widersprüche. So entwickeln sich Kultur und Gesellschaft in einem Kreislauf des Erzeugens, Abarbeitens und Wiedererzeugens von Widersprüchen. In dieser Dialektik von Kultur und Gesellschaft erkennt Münch den Motor der unablässigen Gesellschaftsveränderung. Besonders zeige sich das in den paradoxen Phänomenen des Rationalismus, des Individualismus, des Universalismus und des instrumentellen Aktivismus:
Die Folgen rationaler Entscheidungen sind unberechenbar
Um uns für eine bestimmte Handlungsoption entscheiden zu können, müssen wir uns informieren. Problematisch dabei ist zunächst, dass uns Informationen in einem Ausmaß überfluten, die uns keine Kategorisierung in richtig und falsch, wichtig und unwesentlich erlauben. Darüber hinaus ist das gestern erworbene Wissen morgen schon wieder obsolet, weil sich vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse sehr schnell fortentwickeln. Die Folgen unserer Entscheidungen sind deshalb ungewiss, rationales Denken und Handeln sind nur begrenzt möglich. Wir müssen auf andere Werkzeuge zurückgreifen, unsere Intuition zum Beispiel.
Individualität entsteht als einzigartige Schnittmenge unterschiedlicher sozialer Zugehörigkeiten
In modernen Gesellschaften ist die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen selten obligatorisch und auch nicht notwendig für das Überleben. Der Nachteil ist aber, dass mit der gewonnen Freiheit und Ungebundenheit auch unsere Möglichkeiten sinken, auf Menschen und Gegebenheiten einzuwirken. Innerhalb eines überschaubaren Personenkreises hat unser Einfluss sehr viel mehr Gewicht. Letztlich geraten wir in die Abhängigkeit von willkürlichen Entscheidungen durch Personen, die wir gar nicht kennen und denen wir ebenfalls fremd sind. Außerdem ist Individualismus eine Eigenschaft, die alle Mitglieder einer modernen Gesellschaft zur gleichen Zeit besitzen. Das heißt: Viele Individualisten vertreten eine Vielzahl individueller und heterogener Interessen, die sie regelmäßig auch geltend machen, womit sie die Individualität des Einzelnen gefährden.
Bindungslosigkeit wächst mit der Anzahl unserer Bindungen
Die Intensität der Verbundenheit des Einzelnen mit anderen Individuen entwickelt sich umgekehrt proportional zu der Anzahl der Verbindungen, die er eingeht. Je enger und abgeschlossener der Personenkreis, desto stärker die Bindung. Flexibilität, Kurzfristigkeit und Oberflächlichkeit des aufeinander bezogen seins führen zu Unverbindlichkeit und Ungebundenheit.
Problemlösungsversuche erzeugen neue Probleme
Alle Verbesserungswünsche und Interventionen in Bezug auf Umfeld und Umwelt führen dazu, dass immer neue Probleme entstehen. Besonders geschieht das, wenn es das Ziel ist, Gerechtigkeit und Gleichheit herzustellen. Mittel- bis langfristig bedeutete das in der Geschichte stets einen Nachteil für andere Teile der Gesellschaft.
Diese Paradoxien bedeuten ein Risikopotential moderner Gesellschaften. Während wir versuchen, die Realität dem Ideal anzunähern, existieren sie weiter. Interpenetrationsprozesse und kommunikative Dynamiken können dabei regulierend eingreifen.
Das Konzept der Interpenetration
Dem Wunsch, die Abweichung zwischen Soll- und Istzustand aufzulösen, folgt in der Regel ein Handlungsimpuls. Dieser impliziert stets, dass eine Leistung zu erbringen ist. Wenn wir mehr oder besser leisten, kommen wir dem Ideal näher. Dieser Prozess nimmt jedoch, wie bereits erwähnt, kein Ende. Deshalb gibt es auch für unseren Leistungsanspruch keine Grenze - weder hinsichtlich der Effizienz, noch in Form einer Ausweitung in die Handlungsspielräume anderer soziokultureller Teilsysteme. Wir penetrieren diese Systeme wechselseitig, infizieren sie mit unseren Idealvorstellungen und absorbieren die Intentionen und Handlungsimpulse der jeweils systemfremden Akteure. Besonders deutlich wird das auf Makroebene in den Bereichen Ökonomie und Politik, wo ein Zuviel an Außenleistung erheblichen Schaden verursachen kann.
Die Lösung sieht Münch in einer Entwicklung von expansivem Verhalten hin zu Verzicht und Beschränkung. Dabei müssten entweder alle Akteure gleichermaßen zum Verzicht bereit sein oder die Expansion müsste an vordefinierte und streng reglementierte Prämissen gekoppelt sein. Beides führt erstens zu einem Verlust an Individualismus und zweitens zu Ungleichverteilung und damit potentiell zu ausgeprägtem Unrechtsempfinden oder sogar Fundamentalismus.
Globalisierung, Beschleunigung und Verdichtung der Kommunikation
Gesellschaftliche Teilsysteme besitzen jeweils eigene Orte der Kommunikation, an denen durch Interpenetration verursachte Konflikte ausgetragen werden. Neben einem gesellschaftlichen Zwang zur Kommunikation erkennt Münch darüber hinaus eine Sprach- und Wortinflation:
„Kommunikation fordert Kommunikation heraus. Deshalb ist anzunehmen, dass vermehrte Kommunikation stets noch mehr
Kommunikation erzeugt. Auf Fragen müssen Antworten kommen, auf Antworten neue Fragen, auf Behauptungen Widerlegungen, auf Widerlegungen neue Behauptungen, auf Thesen Antithesen. Kommunikation
produziert sich in diesem endlosen Prozess der Assertion und Negation immer wieder neu und wuchert aus sich selbst heraus unablässig.“
(Richard Münch
in: Dynamik der Kommunikationsgesellschaft, 1995)
Journalismus als Wächter der Kommunikationsgesellschaft
Der Journalismus habe über die Inflation der Worte zu wachen wie die Notenbank über die Geldwertstabilität, sagt Münch. Er muss informieren, analysieren und prüfen, ob Behauptungen wahr sind. Zunehmend übernimmt er zusätzlich eine darstellende und vermittelnde Funktion in öffentlichen Diskursen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die kommunikative Dynamik der Moderne den Journalismus bereits für sich vereinnahmt hat. Außerdem muss er sich in wirtschaftliche Rahmenbedingungen fügen und Journalisten unterliegen einem globalen Konkurrenzdruck. Seiner Kontrollfunktion wird der Journalismus immer dort nicht gerecht, wo er selbst als Akteur die Wortinflation beschleunigt und anfeuert.
Inflationäre Sprache führt zu einer Inflation von politischer Macht
Politik wird nicht mehr medial vermittelt, sondern virtuell, d. h. in der Kommunikationsgesellschaft bilden mediales Berichten über Politik und die Politik selbst eine Einheit. Politiker agieren so, wie es in der Öffentlichkeit am vorteilhaftesten wahrgenommen und thematisiert wird. Was zählt ist somit die Art und Weise, wie argumentiert wird, nicht der Inhalt selbst. Zentrales Motiv ist stets der Wunsch nach Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit. Eine inflationäre Sprache in der Politik bewirkt deshalb inflationäre Tendenzen politischer Machtausübung. Wer viel erzählt und verspricht, der wird einiges davon nicht halten können. Enttäuschte Erwartungen und ein Verlust an Authentizität sind die Folge.
Demokratische Systeme sind auf die Bildung von Mehrheiten angewiesen, die politische Entscheidungen stützen. Je mehr aber die Mehrheiten durch massenmediale Stimmungserzeugung gebildet werden, umso mehr muss erfolgreiche Politik nach den Maßstäben massenmedialer Ereignisproduktion betrieben werden. Leider neigen jedoch Stimmungen dazu, zu schwanken. Politiker müssen deshalb „flexibel“ sein, den Standpunkt mit der Stimmungslage ändern und sich als charismatische Person jeweils neu in Szene setzen. Das bedeutet eine tiefgreifende Veränderung unserer politischen Kultur mit einem drohenden Verlust der Loyalität breiter Bevölkerungskreise:
„Der Weg der Kommunikation geht jetzt nicht mehr vom Ereignis zu dessen Darstellung, sondern vom Inszenierungszwang zur Erzeugung der Ereignisse. Die Differenz von Darstellung und Realität hebt sich auf in der Virtualität eines verselbständigten Inszenierungsstromes. Es gibt keine Realität mehr, anhand derer der Wahrheitsgehalt einer Darstellung geprüft werden könnte.“
(Richard Münch, 1997: Mediale Ereignisproduktion: Strukturwandel der politischen Macht. In: Stefan Hradil (Hrsg.), Differenz und Integration. Die Zukunft moderner Gesellschaften. Verhandlungen des 28. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Dresden 1996).
Münch setzt zur Lösung auf institutionalisierte Vermittler, die den Dialog der unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilsysteme fördern. Seiner Meinung nach können der Staat und große Interessenverbände diese Funktion nicht erfüllen, da diese zu wenig auf Interdisziplinarität setzten. Die Politik müsse sich stattdessen jenseits von Öffentlichkeitswirkung und Inszenierungszwang kompromissbereit auf eine kleinformatigere, inoffizielle Kommunikationsebene zurückziehen. Nur so sei ein systemübergreifender Perspektivenwechsel realisierbar.
Globalisierte Moralprinzipien inflationieren die Privatheit des Einzelnen
Universale und unkonkrete Normen der Moral dringen durch global vernetzte Kommunikation in sehr private und persönliche Bereiche vor. Aufgrund der Universalität und Beliebigkeit dieser Normen kann aber oft kein emotionaler Bezug zu dem mehr oder weniger anonymen Personenkreis hergestellt werden, mit dem wir uns solidarisieren und identifizieren sollen. Empathie erfordert aber ein Mindestmaß an Verbundenheit. Dennoch gelingt es dieser moralischen Universalität mit modernen Kommunikationsformen und starken Bildern, das durch Tradition und persönliche Bindung an uns nahestehende Menschen gewachsene Moralkonstrukt teilweise aufzubrechen. Es wird ersetzt durch einen Appell an unsere Eigenverantwortlichkeit und Handlungsfreiheit in Bezug auf ein sehr allgemeines Moralprinzip:
„Die vom moralischen Universalismus geforderte grundsätzliche moralische Achtung eines jeden wird dann massenhaft durch moralisch verwerfliches Handeln widerlegt. (…) Das sind Wellen der Entwertung moralischer Achtung, die dazu führen, dass entgegengebrachte moralische Achtung immer weniger mit moralisch richtigem Handeln rechnen kann. In der umgekehrten Richtung bedeutet moralische Deflation einen Rückzug der Achtungszuteilung auf die partikularen Lebensgemeinschaften, so dass über ihre Grenzen hinaus überhaupt keine moralische Regulierung des Handelns mehr möglich ist.“
(Richard Münch in: Dynamik der Kommunikationsgesellschaft, 1995)
Hoffnung setzt Münch dabei auf eine Kombination aus kompetentem Umgang mit Medien, der Arbeit von Lobbyisten und verantwortungsvollen politischen Entscheidungsträgern mit einem gemeinsamen moralischen Ziel: Dem größtmöglichen Nutzen der größtmöglichen Zahl an Menschen.
Ausblick
Die Moderne ist widersprüchlich und paradox, sonst könnte sie sich nicht fortlaufend erneuern. In pluralistisch geführten Diskursen können wir nach Wegen suchen, damit umzugehen. Die Dialektik ist dabei die Antriebsfeder. Wir können sie und das daraus resultierende Konfliktpotential zwar teilweise kontrollieren, aber nicht negieren:
„Die modernen Gesellschaften sollen die perfekte Ordnung durch aktives Tun schaffen und verfangen sich zwangsläufig in den Fallstricken der nichtintendierten bösen Folgen guter Absichten. Dieser Stachel im Fleisch der Moderne ist es, der immer wieder neue Versuche veranlasst hat, den Stachel herauszureißen, die Widersprüche an der Wurzel zu packen und die Moderne in ihrem Fundament neu zu einem widerspruchsfreien System zu ordnen. … Als Fundamentalismus einer oppositionellen Minderheit drängt er zu politischem Terrorismus, als Fundamentalismus einer herrschenden Minderheit oder Mehrheit drängt er zum Totalitarismus.“
(Richard Münch in: Dynamik der Kommunikationsgesellschaft, 1995)
© Katja Tropoja
Modernisierungsrisiken sind ein Segen für die Demokratie: Warum wir handlungsunfähig werden, wenn wir die Welt nicht als Risiko entwerfen

© Katja Tropoja
Als der Soziologe Ulrich Beck 1986 mit seinem Buch „Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne“ einen Ausblick auf zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen gab, war die nukleare Katastrophe von Tschernobyl noch nicht eingetreten. Die klassische Industriegesellschaft gehörte aber bereits der Vergangenheit an. Ihre eigene Dynamik bereitete einer reflexiven Modernisierung und infolgedessen der Risikogesellschaft, wie Beck sie nennt, den Weg. In ihr muss sich die einstige Industriegesellschaft mit latenten und selbst erzeugten Modernisierungsrisiken auseinandersetzen. Reflexiv bedeutet hier, dass der Prozess der Modernisierung und dessen Verselbständigung sich selbst zum Gegenstand werden. Deren Eigendynamik beschleunigt Fortschritte in Technik und Wissenschaft. Charakteristisch an diesem Vorgang ist seine Latenz, d. h. er findet zunächst unbemerkt statt- Auf einer zweiten Stufe wird sie jedoch durch die Verwissenschaftlichung der Modernisierungsrisiken aufgelöst.
In der Industriegesellschaft bildete der Wohlstand die Legitimationsgrundlage für wissenschaftlich begründeten, technischen Fortschritt. Die Wissenschaften der Risikogesellschaft beschäftigen sich zusätzlich mit den Folgen ihrer eigenen Aktivitäten und Ergebnisse. So sah Becks Prognose zum damaligen Zeitpunkt aus und in dieser Reflexivität der Wissenschaften erkennt er den eigentlichen Übergang in eine neue Gesellschaftsform:
„Die Konstellationen der Risikogesellschaft werden erzeugt, weil im Denken und Handeln der Menschen und Institutionen die Selbstverständlichkeiten der Industriegesellschaft (der Fortschrittskonsens, die Abstraktion von ökologischen Folgen und Gefahren, der Kontrolloptimismus) dominieren.“
(Ulrich Beck: Die Erfindung des Politischen, 1993).
Kennzeichen risikogesellschaftlicher Strukturen
Beck definiert Risiken als „Modernisierungsprodukt von verhinderungswertem Überfluss.“ Sie sind nicht naturgegeben, sondern entstehen erst im Zuge der Modernisierung und deren Vervielfältigungscharakteristik, stets im Streben nach Reichtum und im Sinne einer „positiven Aneignungslogik“, wie es Beck nennt. Zudem verursachen sie zahlreiche gesellschaftliche Konflikte, die vor allem aus der umgekehrten Proportionalität von Risiko und Reichtum resultieren: Die ärmsten und schwächsten Akteure der Industriegesellschaft hatten das höchste (Lebens-)Risiko zu tragen.
Eine Risikogesellschaft kann sich in erster Linie überhaupt erst entwickeln weil deren Mitglieder die Illusion vom Segensreichtum technisch-wissenschaftlichen Fortschritts nicht aufgeben wollen. Manches reguliert sich bekanntlich von selbst und so bietet die Risikogesellschaft früher oder später ausgleichende Gerechtigkeit: Wir werden alle irgendwann von den Risiken der Modernisierung heimgesucht (Feinstaub, Elektrosmog, Lebensmittelskandale, radioaktive Strahlung, usw.). Umweltprobleme sind ein globales Phänomen, jenseits sozialer Schranken. Waren in der Industriegesellschaft noch Verteilungskämpfe zentrales Thema, fordert die Risikogesellschaft nun Sicherheit und Risikoreduktion.
Risiken zeichnen sich dadurch aus, dass sie nichts Reales haben. Es geht um Ereignisse, die möglicherweise stattfinden. Sicher ist das nicht, deshalb lassen sie sich leicht aus dem Bewusstsein verdrängen:
„In der Risikogesellschaft verliert die Vergangenheit die Determinationskraft für die Gegenwart. An ihre Stelle tritt die
Zukunft, damit aber etwas Nichtexistentes, Konstruiertes, Fiktives als Ursache gegenwärtigen Erlebens und Handelns.“
(Ulrich Beck:
Risikogesellschaft.
Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986)
Ist das befürchtete Ereignis eingetreten, können wir versuchen, die Folgen einzudämmen. Gelingt uns dies nicht, besteht noch die Möglichkeit, das Problem nicht zum Thema zu machen, es nicht in die Öffentlichkeit zu tragen, es zu ignorieren.
Die Risikogesellschaft ist Informations- und Wissenschaftsgesellschaft
Sind Modernisierungsrisiken latent, können wir sie weder erkennen, noch begrifflich konkretisieren. Um dies zu ändern, sind wir auf die Wissenschaften angewiesen. Bei ihnen liegt die Macht zu entscheiden, ob ein Risiko vorliegt oder nicht und wen es persönlich betrifft oder betroffen machen muss. Erst das Wissen darum und die Art und Weise wie dieses Wissen verbalisiert und kommuniziert wird, erzeugt das Risiko im Bewusstsein und somit Betroffenheit.
Wir sind dabei nicht nur auf die Wissenschaften angewiesen, sondern auch auf die mediale Verbreitung wissenschaftlicher Arbeitsergebnisse durch Medien. Es ist dabei durchaus möglich, dass Menschen, die besonders stark von einem Risiko betroffen sind, gar kein Bewusstsein davon haben, weil ihnen das Wissen fehlt. Wessen Existenz unmittelbar bedroht ist, wer gegenwärtig um sein Überleben kämpft, für den sind zukünftige Risiken nicht relevant. Umgekehrt werden Menschen zu Risikoexperten, obwohl es sie nicht unmittelbar betrifft und sie auch direkt keine Einflussmöglichkeit haben.
Wissenschaftliche Forschungsergebnisse werden in der Regel auch umgesetzt. Vor allem in der Industrie ist das so und hier unterliegen sie der kommerziellen Nutzung. Anschließend brauchen wir die Forschung, um Risiken der Ergebnisanwendung zu beseitigen. Ob es ein Risiko überhaupt gibt, ist dabei abhängig von wirtschaftlichen Interessen bestimmter Akteure:
„Die Produktion von Risiken und ihre Verkennung hat also ihren ersten Grund in einer ökonomischen Einäugigkeit der
naturwissenschaftlich-technischen Rationalität. Deren Blick ist auf die Produktivitätsvorteile gerichtet. Sie ist damit zugleich mit einer systematischen Risikoblindheit geschlagen.“
(Ulrich Beck: Risikogesellschaft.
Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986)
Dadurch entstehen immer neue Risiken und folglich eine Reflexivität der Wissenschaft. Das heißt, die Risikobewältigung fällt immer wieder auf die Wissenschaft
zurück, obwohl sie kaum Einfluss darauf hat, wie und durch wen ihre Forschungsergebnisse letztlich genutzt werden.
Organisierte Unzurechenbarkeit und Unüberschaubarkeit
In den Wissenschaften ist vor allem der hohe Differenzierungs- und Spezialisierungsgrad problematisch. Die Heterogenität der Forschungsergebnisse bietet viele
verschiedene Varianten der Interpretation. Zudem sind Risiken niemals isoliert zu betrachten, sondern ihre Komplexität kann nur
im Zusammenhang erkannt und bewertet werden. Das führt zu einer Unüberschaubarkeit für Akteure anderer Teilsysteme.
Das Streben nach Wachstum und Reichtum in neoliberalen Wirtschaftssystemen beschränkt das Eingreifen des Staates in wissenschaftliche und ökonomische Prozesse. Die moderne Gesellschaft hat kein Steuerungszentrum, sagt Beck. Deshalb vermittle der Staat dem Einzelnen „Entwicklungsrichtung und Ergebnis des technischen Wandels als Ausdruck unausweichlicher technisch-ökonomischer Sachzwänge.“
Diese „Sachzwänge“ rechtfertigen wiederum die Handlungen einzelner Akteure und dynamisieren die Entwicklung der Risikogesellschaft:
„Die Entscheidungen, die die Gesellschaft verändern, haben keinen Ort, an dem sie hervortreten können, werden sprachlos und
anonymisiert. In der Wirtschaft werden sie in Investitionsentscheidungen eingebunden, die das gesellschaftsverändernde Potential in die ungesehene Nebenfolge abdrängen. Die empirisch-analytischen
Wissenschaften, die die Neuerungen vordenken, bleiben in ihrem Selbstverständnis und ihrer institutionellen Einbindung von den technischen Folgen und den Folgen der Folgen, die diese haben,
abgeschnitten.“(Ulrich Beck: Risikogesellschaft.
Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986)
Politische Entscheidungen dienen schließlich nur noch dazu, Handlungen anderer Akteure zu legitimieren. Letztlich ist niemand wirklich verantwortlich, weil unterschiedliche Modernisierungsrisiken von verschiedenen Teilsystemen erzeugt werden und alle zur gleichen Zeit zuständig sind. „Fortschritt ist die in die Unzuständigkeit hineininstitutionalisierte Gesellschaftsveränderung“, sagt Beck. Alle agieren nur innerhalb ihres ausdifferenzierten Teilsystems.
Dynamische Individualisierungsprozesse als Risiko und Chance
Die einzelnen Akteure der Risikogesellschaft müssen für Modernisierungsrisiken zunehmend sensibilisiert sein, wenn sie handlungsfähig bleiben wollen. Sie müssen wissen, dass ihre Ursache in den jeweiligen Teilsystemen liegt. Individualisierungstendenzen führen laut Beck dazu, dass jeder auf sich selbst bezogen und zurückgeworfen ist und dass sich jeder hauptsächlich der Planung des eigenen Lebenslaufs widmet. Er sieht sie als Nebenprodukt des reflexiven Charakters der Risikogesellschaft und definiert sie als Abspaltung von sozialen Gefügen, wie sie in der Industriegesellschaft üblich waren. Damit meint er soziale Klassen, familiäre Traditionen, geschlechtsspezifische Kategorien. Das führt u. a. dazu, dass sich Biographien von Männern und Frauen schwerer synchronisieren lassen als das in der Industriegesellschaft der Fall war. Flexible Lebensführung ist mit dauerhafter Bindung kaum vereinbar. Bemerkenswert dabei ist, dass aber gerade die Industriegesellschaft dieser Tendenz den Weg bereitet hat:
„Die freigesetzten Individuen werden arbeitsmarktabhängig und damit bildungsabhängig, konsumabhängig, abhängig von sozialrechtlichen Regelungen und Versorgungen, von Verkehrsplanungen, Konsumangeboten, Möglichkeiten und Moden in der medizinischen, psychologischen und pädagogischen Beratung und Betreuung.“
(Ulrich Beck: Risikogesellschaft.
Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986)
Laut Beck liegt aber dennoch der Schlüssel zum Ausstieg aus der Risikogesellschaft eben genau im Bezug des Individuums auf sich selbst und in dessen vollständiger Übernahme der Verantwortung für das eigene Leben. Das soll jedoch nicht ausschließlich innerhalb des eigenen Teilsystems geschehen, sondern systemübergreifend und außerhalb der Institutionen. Individualisierung schafft und erweitert somit Handlungsspielräume und dem Individuum stehen viele Wege offen. Es muss sich permanent für oder gegen etwas entscheiden. Dabei ist es stets gezwungen, autonom zu sein, wenn alle übrigen Teilsysteme nicht zuständig sind.
Im Sinne Sartres sagt Beck:
„Der Mensch wird zur Wahl seiner Möglichkeiten, zum homo optionis. Leben, Tod, Geschlecht, Körperlichkeit, Identität, Ehe, Elternschaft,
soziale Bindungen – alles wird sozusagen bis ins Kleingedruckte hinein entscheidbar, muß, einmal zu Optionen zerschellt, entschieden werden.“
(Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim: Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften,
1994)
Distanz zu den Teilsystemrationalitäten und Entdifferenzierung
Wer Abstand zum Teilsystem gewinnt, kann sich den Sozialrationalitäten widmen. Das gelingt noch besser, wenn man es schafft, in Kontexten zu denken und sich sozial zu entdifferenzieren. Indem die Politik ihre Verantwortlichkeit und damit auch einen Teil ihrer Macht teilweise auf den individualisierten, politisierten Akteur überträgt, kann dieses Ziel erreicht werden. Das bedeutet auch, dass sich die Politik in manchen Teilbereichen damit abfinden muss, handlungsunfähig zu sein und sie sollte das auch öffentlich zuzugeben. Nur so lässt sich institutionell organisierte und latente Unverantwortlichkeit überwinden. Dazu bedarf es der Unabhängigkeit der Justiz, leistungsfähigen Medien mit hoher Reichweite und eines funktionierenden Bildungssystems, das zu politisch verantwortungsbewusstem Handeln befähigt:
„Die Bewältigung der Risiken zwingt zum Überblick, zur Zusammenarbeit über alle sorgfältig etablierten und gepflegten Grenzen hinweg. … Insofern werden in der Risikogesellschaft die Entdifferenzierung der Subsysteme und Funktionsbereiche, die Neuvernetzung der Spezialisten, die risikoeindämmende Vereinigung der Arbeit das systemtheoretische und –organisatorische Kardinalproblem.“
(Ulrich Beck: Risikogesellschaft.
Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986)
Die Verantwortung der Wissenschaft für den Abbau von Unsicherheiten
Die Wissenschaften besitzen keine Mystik. Expertenwissen muss keine Geheimnisse verbergen, sondern darf öffentlich kommuniziert werden. Die Definition von Risiken muss über den wissenschaftlichen Weg geschehen und das geht immer mit einem erheblichen Konfliktpotential zwischen den einzelnen Disziplinen einher. Deshalb und weil man sich vor der Auseinandersetzung mit zum Teil selbstverursachten Problemen scheut, gibt es eine gewisse Zurückhaltung des Wissenschaftsbetriebes, sich dieser Verantwortung zu stellen. An dieser Stelle ist jeder politisierte Einzelakteur und somit die gesamte Gesellschaft gefragt. Alle müssen wachsam sein und riskante Sachverhalte konsequent an die Öffentlichkeit bringen. Gelingt dies nicht, dann geraten Fragestellungen in nichtwissenschaftliche Sphären, die eigentlich einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung bedürften. Ebenso unwissenschaftlich fallen dann oftmals die Antworten aus.
Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit müssen die Wissenschaft dazu auffordern, sich den Risiken empirisch zu stellen, den Grad der Differenzierung bei den Einzeldisziplinen zu minimieren und verstärkt kooperativ zusammenzuarbeiten. Dabei muss es gleichzeitig aber auch möglich sein, ungestraft Fehler zuzugeben, Forschungsergebnisse und darauf aufbauende Maßnahmen notfalls rückgängig zu machen und seine Meinung zu ändern.
Voraussetzung für diese Maßnahmen ist wiederum eine moderne, demokratische Gesellschaft:
„Reflexive Modernisierung, die auf die Bedingungen hochentwickelter Demokratie und durchgesetzter Verwissenschaftlichung trifft, führt
zu charakteristischen Entgrenzungen von Wissenschaft und Politik. Erkenntnis- und Veränderungsmonopole werden ausdifferenziert, wandern aus den dafür vorgesehenen Orten ab und werden in einem
bestimmten, veränderten Sinne allgemeiner verfügbar.“
(Ulrich
Beck: Risikogesellschaft.
Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986)
© Katja Tropoja
Die Moderne als Co-Produktion von Rationalisierung und Subjektivierung

© Katja Tropoja
Mit seiner Gegenwartsdiagnose der modernen Gesellschaft „Critique of Modernity“ von 1992 erforscht und beschreibt der französische Soziologe Alain Touraine wie Rationalisierungs- und Subjektivierungsprozesse und deren kollektive Akteure zur Entwicklung der modernen Gesellschaft beitragen und wohin sich diese bewegen könnte. Dabei ist sein Blick ein hoffnungsvoller, denn er glaubt an ein Gleichgewicht von Rationalisierung und Subjektivierung.
Die Moderne als gesellschaftlicher Rationalisierungsvorgang
Die „Rationalisierung der Weltbeherrschung“, wie Max Weber schon 1920 dieses mehrdimensionale Kennzeichen der Moderne nannte, beschreibt eine kanonisierte Sicht der Moderne. Es geht zunächst um Zweckrationalität im herkömmlichen Sinn, d. h. um den möglichst effizienten Einsatz von Ressourcen, um ein vordefiniertes Ziel zu erreichen. Darüber hinaus fördern Verallgemeinerungen eine theoretische Rationalität, wenn es um die Herstellung kausaler Zusammenhänge geht. Immer wieder neues Hinterfragen kostet Zeit und Energie und wird als ineffizient erachtet. In eine ähnliche Richtung führt die formale Rationalität, die auf eine universale Anwendung von Regeln und Normen zielt. Für die vierte Form, die Wertrationalität, ist der zuvor eindeutig definierte Gegenstand des Wollens das Maß, an dem sich alles Streben und Handeln orientiert. Sie sorgt dafür, dass sich unterschiedliche Sphären von Wertvorstellungen und somit sämtliche Teilsysteme, die in der Moderne zu finden sind, ausdifferenzieren können. Gemeint sind damit Ökonomie, Rechtswesen, politisches Leben und Wissenschaft ebenso wie Religiosität, Liebe, Kunst, usw.
In der Moderne gibt es stets eine Wechselwirkung dieser Teilbereiche und somit auch Konflikte zwischen ihnen. Deshalb muss jeder Bereich seine eigenen Regeln und
Normen entwickeln, um sich zu behaupten. Alle Formen der Rationalität bedingen sich damit gegenseitig und sind aufeinander
angewiesen. Das erfordert eine Kultivierung der Zweckrationalität, sowie der theoretischen und formalen Rationalität und beflügelt diese zugleich.
Subjektivität und Rationalität als Produzenten der Moderne
Touraine ergänzte Webers Ansatz um den Aspekt der Subjektivierung. Aus seiner Sicht stehen beide Prinzipien gleichberechtigt nebeneinander, sie fördern und fordern sich gegenseitig: Das Subjekt rechtfertigt Rationalisierungsschritte und die damit verbundenen Auswirkungen mit dem unverzichtbaren Streben nach Individualität und Selbstverwirklichung, die durch wissenschaftlichen Fortschritt erst ermöglicht werden. Rationalisierung stellt sich als besondere Eigenschaft von Subjektivierungsprozessen dar: Dinge werden hinterfragt, wissenschaftlich analysiert, auf ihre Effizienz und Normierungsfähigkeit hin geprüft, alles im Sinne und zum Wohl des selbstbestimmten Individuums.
In der Frühmoderne löste das Bewusstsein der eigenen Selbstwirksamkeit die vor allem religiös begründete Begrenztheit des menschlichen Daseins ab, vor allem in Bezug auf wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. Der Mensch als Gestalter hat der Moderne Eigendynamik verliehen. Nutzenorientierung und der Wunsch nach Perfektionierung sind die vorrangigen Leitlinien in der modernen Gesellschaft. Wer sich damit konform verhält, ist im Bewusstsein der eigenen Subjektivität individueller, besonderer, einzigartiger und selbstbestimmter Träger dieser modernen gesellschaftlichen Weltordnung.
Subjektivität und Rationalisierung können sich gegenseitig nicht negieren und keines kann auf das andere verzichten, auch wenn die Rationalität seit der Frühmoderne gegen das Subjekt arbeitet und versucht, die Oberhand zu gewinnen.
Siegeszug der Rationalisierung auf Kosten der Subjektivierung
Rationalisierung verpflichtet uns zur Perfektionierung in allen Lebensbereichen. Sie fordert uns auf, über uns hinaus zu wachsen, unsere Leistung zu steigern, mehr Reichtum zu erlangen, mehr Macht auszuüben, erstaunlichere Forschungsergebnisse zu erzielen, tiefere Liebe zu empfinden, ein sensationelleres Kunstwerk zu erschaffen, usw. Es hört nie auf. Begrenzung finden wir nicht in einem göttlichen Willen, sondern in unserer persönlichen Vorstellungskraft.
Der Fortschritt sucht nach einer Legitimitätsgrundlage und findet sie in der menschlichen Subjektivität, im Drang nach selbstbestimmter Individualität. Rationalisierung bewirkt, dass der Fortschritt seine Daseinsberechtigung selbst begründen kann, das Subjekt ist dafür nicht mehr notwendig. Schlimmer noch: Sie wird nicht nur verworfen, sondern zusätzlich der Rationalität auch noch unterworfen. Alles unter dem Deckmantel vorgegebener, „vernünftiger“ Zweckimperative. Wer sich dem nicht beugt muss mit Stigmatisierung und Diskriminierung rechnen. Darin sieht Touraine die eigentliche „crisis of modernity“, ein Prozess, der sich in drei Etappen vollzieht: Nachdem sie die Aufgabe von Subjektivität verursacht hat, gerät gesellschaftliche Rationalisierung in ein Stadium der Unfähigkeit, sinngebende Ziele vorzugeben. Sie ist nicht einmal mehr in der Lage, diese überhaupt zu erlauben. Darauf folgt eine Radikalisierung der kritischen Auseinandersetzung mit den Erscheinungsformen der Moderne. Vor allem verurteilen Modernisierungsgegner den betrügerischen Charakter und letztlich das Scheitern des Fortschritts, der nicht hält, was er versprochen hat. Was übrig bleibt ist ein Zwang zur Konformität, der durch drohende Sanktionen abgesichert ist. Die Autonomie eines selbstbestimmten Individuums wird als zu vernachlässigende Komponente ausgeklammert und zur Nebensache erklärt. Der hohe Grad an Ausdifferenziertheit und Rationalisierung gesellschaftlicher Sphären gefährdet die Selbstständigkeit des Subjektes.
Für einige Zeit koindizierten Rationalisierung und Subjektivierung im Individualismus des Bürgertums. Bemerkenswert ist auch,
dass vor allem die religiöse Reaktion auf die Aufklärung einen entscheidenden Schub für Subjektivierungsprozesse bedeutet hat: Der Mensch ist nicht materialistisch auf seinen Körper reduzierbar,
sondern besteht aus Körper, Geist und Seele. Die Religion dient so als Verankerung eines nicht Rationalisierbaren, das den Wesenskern des Menschen ausmacht und somit als Schutzzone für
Subjektivität.
Hoffung auf „full modernity“ in Freiheit
Touraine ist zuversichtlich und setzt seine Hoffnung auf soziale Bewegungen, deren vorrangiges Ziel die Selbstbestimmung ist. Durch Bündelung von Ressourcen und Bildung von Kooperationen sollen sie die individuelle Subjektivierung zum Leben erwecken – entweder durch Reform oder durch Revolution. Es ist der kollektive Widerstand gegen die Rationalisierung, in dem sich die individuelle Subjektivierung vollzieht.
Für Touraine ist Freiheit im Sinne von Selbstbestimmtheit eine notwendige Voraussetzung, weil sie sinnstiftende Bindungen an kulturelle Werte, Lebensstile und Gemeinschaften gegen teilsystemische Rationalisierungen verteidigt. Darüber hinaus hat sie die Aufgabe, das Subjekt an dessen Autonomie in Bezug auf diese Bindungen zu erinnern, damit es deren Imperativen widerstehen kann.
Das Subjekt spielt mittels seiner Freiheit dauerhaft Rationalität gegen tradierte Bindungen aus und umgekehrt. Es gewinnt genau dadurch in einer antagonistischen Kooperation mit moderner Rationalität seine Freiheit. Dies geschieht im Bewusstsein, dass beide grundsätzlich miteinander unvereinbar sind. Die Subjektivität ist dabei stets das gefährdetere der beiden Prinzipien und braucht deshalb Unterstützung durch institutionalisierte Diskussionsforen und Dialogformen, damit sie auf die Mobilisierung vormoderner Kooperationspartner verzichten kann. Sonst ist die Versuchung groß, jede Form der Rationalisierung sofort zu verwerfen.
© Katja Tropoja
Konstruierte Natur und naturwüchsige Gesellschaft: Warum die Moderne sich selbst belügt
© Katja Tropoja
Hauptforschungsbereich des französischen Sozialwissenschaftlers Bruno Latour ist die Wissenschafts- und Technikforschung, unter Einbeziehung gesellschaftstheoretischer Aspekte. Mit einem seiner Hauptwerke „Nous n’avons jamais été modernes“ (Wir sind nie modern gewesen) von 1991 stellte er die Produkte naturwissenschaftlicher Forschung in den Kontext ihrer soziokulturellen Entstehung. Ausgangspunkt war die These, dass alles, was wir bisher an Erkenntnissen über die natürliche Beschaffenheit von Materiellem gewonnen haben, im Rahmen eines sozialen Gefüges kognitiv von uns konstruiert ist. Darüber hinaus haben Zielsetzung und Strategie der forschend Tätigen erheblichen Einfluss darauf, welches Wissen publiziert wird. Regelmäßig findet „Enrollment“ statt, d. h. unterschiedliche Interessengruppen bilden Allianzen, um bestimmte Forschungsziele zu propagieren und zu etablieren. Dazu gehören vor allem die Medien, sowie die Justiz mit ihrem Streben nach rechtlicher Normierung, so zum Beispiel in der Genforschung.
Im nächsten Schritt untersuchte Latour, in wie fern das gesellschaftsstrukturelle Einwirken auf Naturwissenschaft und Technik die moderne Gesellschaft beeinflusst. Im Mittelpunkt steht die Frage nach den Auswirkungen dieser als objektiv dargestellten Ergebnisse von Wissenschaftsproduktion, bei denen es sich um konstruierte Artefakte handelt, auf unterschiedliche Teile der Gesellschaft.
Latour erläutert das beispielhaft an einem Zeitungsartikel, der das Loch in der Ozonschicht zum Gegenstand hat:
„(…) Ein und derselbe Artikel vermischt chemische und politische Reaktionen. Ein roter Faden verbindet die esoterische Wissenschaft mit den
Niederungen der Politik, dem Himmel über der Antarktis mit irgendeiner Fabrik am Rande von Lyon, die globale Gefahr mit der nächsten Wahl oder
Aufsichtsratssitzung.“
(Bruno Latour: "Wir sind nie modern gewesen“, 1991)
Sein Zwischenfazit lautet:
Die Verbindung von Natur und Gesellschaft ist untrennbar. Es gibt keine Abgrenzung und die „Hybride“ breiten sich aus.
Die Gesellschaft aus dem Labor
Hybride sind Nebenprodukte des Zusammenwirkens von Natur und Gesellschaft. Sie sind kein modernes Phänomen, denn seit der Mensch im Rahmen des technischen Fortschritts Werkzeuge entwickelt, konstruiert und benutzt, expandieren und vervielfältigen sie sich. Neu und modern ist aber, dass Hybride uns immer begleiten und dass sie sich mit hoher Geschwindigkeit vermehren. Sie gehören stets zu unserer Gegenwart und hinzu kommt, dass sie größtenteils nicht wahrgenommen werden. Wird man auf sie aufmerksam, dann werden sie fehlinterpretiert.
Reproduktionsstätte für Hybride ist hauptsächlich das Labor, meint Latour. Hier verschmelzen Natur und Gesellschaft ineinander. Hier entsteht die Grundlage der modernen Gesellschaft, die Gesellschaft aus dem Labor. Das bezeichnet Latour als den „fundamentalsten Aspekt unserer Kultur“. Für ihn garantieren Hybride überhaupt erst die soziale Ordnung und sie haben die Macht, diese auch wieder zu zerstören.
Entkopplung von Reden und Handeln
Problematisch wird es, wenn Reden und Handeln nicht übereinstimmen. Dass jemand anders handelt als er sollte, weil er es muss, ist nicht ungewöhnlich. Dann aber so zu reden, als ob man so handelt, wie man sollte, verkompliziert die Angelegenheit. Das kommt besonders beim modernen Umgang mit Hybriden zum Tragen.
Die Moderne glaubt, was sie sich selbst erzählt und täuscht sich damit selbst. Die größte Täuschung besteht dabei in der Separiertheit von Gesellschaft und Natur: Letztere ist „im Außen“. Wir haben sie nicht erschaffen, verändern und formen sie aber permanent und erfolgreich. Im Gegensatz dazu ist die Gesellschaft ein menschliches Produkt. Dennoch schafft es der moderne Mensch nicht, sie vollständig zu kontrollieren. Sie ist nicht planbar. Tatsächlich findet eine Vergesellschaftung des Natürlichen statt. Die moderne Gesellschaft nimmt dagegen ihren natürlichen Lauf, ihre Natur entgleitet uns und verselbstständigt sich. Die Moderne blendet diese Tatsachen aus. Sie verhält sich, als sei die Natur kein Konstrukt und die Gesellschaft kein Ergebnis eines natürlichen Prozesses. Sie leugnet es, indem sie einerseits durch Netzwerkbildung (Hybride) zwischen Natur und Gesellschaft vermittelt, um dann andererseits immer darauf bedacht zu sein, eine klare Trennung beider Sphären zu betonen. Wesentliches Merkmal der Moderne ist also die Selbsttäuschung. Diese besteht auch in der Behauptung, Hybridbildung sei beherrschbar. Tatsächlich hat sich ihre Vervielfältigung längst verselbstständigt. Der Effektivität der Reinigungsarbeit, des Redens, ist in einem kritischen Zustand. Sie ist es, weil die Vermittlungstätigkeit, das Handeln, mehr Schaden verursacht als dass sie von Nutzen wäre.
Erfolg durch Selbsttäuschung
Wie bereits erwähnt, kannten schon vormoderne Gesellschaften den Akt der Vermittlung (Hybridbildung). Das kann es demnach nicht sein, was die
Moderne ausmacht. Der Unterschied liegt vielmehr darin, was selbsttäuschend über die Handlung erzählt wird:
Der Reinigungsprozess, der Natur von Gesellschaft sauber trennt.
Er ermöglicht die Herrschaft der Gesellschaft über die Natur durch Hybride und identifiziert das als Erfolgsfaktor. Das haben die „Vormodernen“ nicht gemacht. Natur und Gesellschaft waren eins,
nämlich beides beseelt, gottgegeben und von vorn herein miteinander verwoben, ohne menschliches Zutun. Diese Beseeltheit galt auch für menschliche Artefakte. Jeder willkürliche Eingriff konnte
dieses Gebilde aus dem Gleichgewischt bringen.
Hybridbildung ist kontrollierbar
Die Vorgehensweise ist immer ähnlich: Zuerst werden die Vorteile technischer Entwicklungen und naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse betont, anschließend wird darauf hingewiesen, dass negative Begleiterscheinungen nur mit Hilfe der Wissenschaft beseitigt werden können.
Die Lösung liegt laut Latour darin, die Verbindung von Natur und Gesellschaft zu akzeptieren. Natur darf weiterhin beherrscht werden, auch Hybride darf es geben, man darf ihr Dasein aber nicht leugnen. Sie dürfen sich auch vermehren, man dürfe nur nicht behaupten, sie hätten keine Vermittlungsfunktion. Dann wären Reden und Handeln wieder aneinander gekoppelt und man hätte die Vorteile des für die Moderne typischen Dualismus vereint mit den Vorzügen des Monismus der Vormoderne.
Zu diesem Zweck schlägt Latour die Bildung eines Forums von Akteuren innerhalb eines hybriden Netzwerkes vor, d. h. Naturwissenschaftler, Ingenieure, von der Innovation unmittelbar Betroffene, usw. Dort haben sie die die Gelegenheit, über Natur- und Gesellschaftsbedingtheit ihres Handelns und dessen Folgen zu reflektieren und über die von ihnen selbst erzeugte „Objekt-Diskurs-Natur-Gesellschaft“ zu reden.
„Wer am meisten über Hybride
nachdenkt, verbietet sie soweit wie möglich; wer sie dagegen ignoriert, indem er alle gefährlichen Konsequenzen ausblendet, entwickelt sie, soweit er kann.“
(Bruno Latour: "Wir sind nie modern gewesen“, 1991)
© Katja Tropoja
Die Epidemie des Wertes im hyperrealen Raum: Wie aus der Repräsentationskraft von Symbolik virale Simulation entsteht
© Katja Tropoja
Der französische Philosoph und Soziologe Jean Baudrillard entwickelte eine Zeichentheorie auf der Grundlage existenzialistischer Anthropologie. Henri Lefèbvres Arbeiten über die Entfremdung des Alltagslebens und die urbanistische Moderne hatten ihn dabei stark beeinflusst, ebenso wie die Konzepte der Situationistischen Internationale und der Strukturalismus.
In den 1970er Jahren lautete die zentrale These seiner Zeichentheorie: Industrieprodukte haben nicht länger den Stellenwert von Gütern als Mittel zur Bedürfnisbefriedigung, sondern werden zum Fetisch innerhalb eines Raumes, in dem sich alles auf sich selbst bezieht. Den Begriff „Verbrauch“ hielt er für unzutreffend, da dieser ein Ende des Bedürfnisses impliziere. Tatsächlich höre aber der Prozess des Aufgefordert Werdens niemals auf.
Es gibt eine wissenssoziologische Grundlage für die Beschleunigung und Emanzipation freier flottierender Zeichen
Wer eine These aufstellt, muss akzeptieren, dass es keinen endgültigen Anspruch auf Wahrheit dieser Behauptung gibt, denn es gibt viele unterschiedliche Perspektiven, die durch eine Vielzahl von Akteuren auch wirksam artikulierbar sind. Deren Reichweite ist groß. Baudrillard bezeichnete das als schicksalhaftes Faktum für die Kultur des Abendlandes. Die Ursache dafür sah er in einer rasanten Beschleunigung und dynamischen Veränderung bei der (Um-)Bezeichnung der Dinge. Dabei kommt es zur Emanzipation der Zeichen vom Bezeichneten, ihre Verbindung löst sich allmählich auf. Dieser Vorgang gipfelt in der Entstehung einer Simulationsgesellschaft, so Baudrillard in: „Der symbolische Tausch und der Tod“, 1976.
Diese modernen Zeichen, die Baudrillard meint, nennt er Simulakren (simulacre: das Trugbild, das Blendwerk, die
Fassade,
der Schein). Zwischen ihnen und dem Bezeichneten gibt es keine Verbindung. Sie muss erst über den Umweg der Verstandesleistung hergestellt werden. Im Gegensatz dazu unterscheidet das
Symbol nicht zwischen Zeichen und Bezeichnetem, sondern repräsentiert letzteres. Anschaulich stellt Baudrillard das am, auf moderne Weise verwissenschaftlichen, Begriff des Todes dar: Die Moderne
hat ihn materialisiert und naturalisiert. In vormodernen, archaischen“ Gesellschaften hatte er dagegen stets die Form einer sozialen Beziehung, wie jede andere naturgegebene und sinnlich
erfassbare Erscheinung auch.
Der Zeichenwandel durchläuft vier Entwicklungsstadien der Verselbständigung
Zeichen verwandeln sich von ihrer archaischen Form in eine emanzipierte und übernehmen ihre Systemorganisation selbst, wobei die Gesellschaft außen vor bleibt.
„Emanzipation des Zeichens: Entbunden von der archaischen Verpflichtung, etwas bezeichnen zu müssen, wird es
schließlich frei für ein strukutrales oder kombinatorisches Spiel, in der Folge einer totalen Indifferenz und Indetermination, die die frühere Regel einer determinierten Äquivalenz
ablöst."
(Jean Baudrillard: "Der symbolische Tausch und der Tod“, 1976)
Imitierende Zeichen
Mit Beginn der Renaissance und der Auflösung feudaler Ordnungssysteme hatten Zeichen einen imitierenden Charakter in Bezug auf Mensch und Natur.
„Im Simulakrum einer Natur findet also das moderne Zeichen seinen Wert. Die Problematik des Natürlichen, die Metaphysik
von Realität und Schein ist seit der Renaissance die der Bourgeoisie insgesamt: Spiegel des bürgerlichen Zeichens, Spiegel des klassischen Zeichens. Noch heute ist die Nostalgie einer natürlichen
Referenz des Zeichens lebendig.“
(Jean Baudrillard: "Der symbolische Tausch und der Tod“, 1976)
So war zum Beispiel das antike Theater noch an die Symbolik der Mythologie gekoppelt, während das Theater des Barock bereits das Dasein des Menschen in seiner natürlichen Form darstellte und auf distanzierte Weise imitierte.
Produzierende Zeichen
Mensch und Natur sind ab dem Beginn der Industrialisierung nicht mehr Bezugspunkt von Simulakren und sind nicht länger auf eine bestimmte Funktion fixiert. An ihre
Stelle treten das Produktionsergebnis und der Tauschwert: „Man wendet sich ab vom Naturgesetz und seinen Formspielen und geht über zum Marktgesetz des Wertes und seinen
Kräftekalkulationen.“
(Jean Baudrillard in: „Der symbolische Tausch und der Tod“.)
Ein Beispiel dafür ist die Maschine. Sie imitiert nicht, sondern sie ist selbst ein Symbol für effektive Produktivität. Auch die Arbeit selbst ist ein solches Simulakrum, denn ihr Bezugspunkt ist
die Wertschöpfung, nicht der Mensch. Ebenso ist das Geld hier einzuordnen. Während es sich als imitierendes Zeichen noch auf naturgegebene Tauschwerte bezog, ist es auf dieser zweiten Stufe „die
erste Ware, die Zeichenstatus erlangt und dem Gebrauchswert entkommt. Es ist die Verdoppelung des Tauschwertsystems in einem sichtbaren Zeichen, und in dieser Eigenschaft das, was den Markt (und
damit auch den Mangel) in seiner Transparenz veranschaulicht.“ (a. a. O.)
Strukturale Zeichen
Sie beziehen sich ausschließlich auf ihre eigenen Strukturen. Weder die Natur, noch Effektivität oder Produktivität stellen Bezugspunkte dar, sondern modellhafte Erscheinungsformen. Damit ist der Eintritt in das „simulative Zeitalter“ vollzogen. Beispiele dafür sind Politik, Ökonomie, Wissenschaft, Kultur, Sexualität und Mode. Darüber hinaus gewinnt auch die Arbeit einen strukturalen Charakter, nämlich die Notwendigkeit von Beschäftigung als Anwesenheitsverpflichtung, ohne finalen Bezugspunkt in Form von Produktivität und Konstruktivität.
„Die Menschen müssen überall fixiert werden, in der Schule, in der Fabrik, am Strand, vor dem Fernseher oder in der
beruflichen Weiterbildung - eine permanente und generelle Mobilisierung. Diese Arbeit ist jedoch nicht mehr im ursprüngichen Sinne produktiv: Sie ist nur noch der Spiegel der Gesellschaft, ihr
Imaginäres, ihr phantastisches Realitätsprinzip.“
(Jean Baudrillard: "Der symbolische Tausch und der Tod“, 1976)
In den Ausprägungsformen der modernen Informations- und Kommunikationsgesellschaft erkannte Baudrillard am deutlichsten den Verlust der Symbolik, zugunsten emanzipativer Simulation, denn „die Medien sind dasjenige, welches die Antwort für immer untersagt, das, was jeden Tauschprozess verunmöglicht. (…) Darin liegt ihre wirkliche Abstraktheit. Und in dieser Abstraktheit gründet das System der sozialen Kontrolle und der Macht.“ (Jean Baudrillard in: „Kool Killer oder der Aufstand der Zeichen“, 1978).
Virale, fraktale, bestrahlte Zeichen
Es gibt nichts mehr, worauf sie referieren, weder auf Natur und Mensch, noch auf bestimmte Codes: „Der Wert strahlt in alle Richtungen, in alle Lücken, ohne irgendeine Bezugnahme auf irgendetwas, aus reiner Kontiguität.“ (Jean Baudrillard, in: „Transparenz des Bösen. Ein Essay über extreme Phänomene“, 1990). Besonders deutlich wird das für die Simulakren Arbeit und Geld, in Form einer Abspaltung der Realwirtschaft von den nun autonomen Finanz- und Kapitalmärkten: „Die Ökonomien produzieren schließlich weiter, obwohl die kleinste logische Folge von Schwankungen der fiktiven Ökonomien bereits ausreichen würde, um sie zu vernichten.“ (a. a. O.). Arbeit dient jetzt dazu, Konsumfähigkeit zu garantieren und ein hohes Gütervolumen in Umlauf zu bringen, es dort zu halten und möglichst zu steigern.
jenseits des realen
Virale Simulakren rebellieren und produzieren ihre eigenen Realitäten, aus denen wieder neue Simulakren entstehen. Diese ersetzen reale Ereignisse und bewahren diese in einem hyperrealen Raum.
„Heute ist alles befreit, das Spiel ist gespielt, und wir stehen gemeinsam vor der
entscheidenden Frage:
WAS TUN NACH DER ORGIE?...
Das ist der Zustand der Simulation, in dem wir alle Szenarios nurmehr durchspielen können, weil sie bereits stattgefunden haben - real oder virtuell. Das ist der
Zustand der realisierten Utopie, der Zustand aller realisierten Utopien, in dem man paradoxerweise weiterleben muss, als ob sie nicht realisiert wären.“
(Jean Baudrillard: "Transparenz des Bösen. Ein Essay über extreme Phänomene“, 1990)
© Katja Tropoja
Wir müssen immer MEHR wollen, damit die Eintrittskarte nicht verfällt
© Katja Tropoja
„Der Bürgerstatus und die Bürgergesellschaft sind Errungenschaften der Zivilisation. Sie waren immer wieder gefährdet, überall unvollkommen aber doch zumindest möglich, weil sie immerhin hier und da wirklich waren und sind. Diese Errungenschaften bleiben jedoch so lange unbefriedigend, ja verstümmelt, wie sie mit dem Ausschluss anderer verbunden sind.“
(Ralf Dahrendorf : "Der moderne soziale Konflikt“, 1992)
Ralf Dahrendorf, Professor für Soziologie und zwischen 1969 und 1970 Mitglied des Bundestages, präsentierte mit seinem 1992 erschienenen Buch „Der moderne soziale Konflikt“ eine Sozialanalyse der Bürgergesellschaft. Demnach hat das Streben nach Erlangung von Grundrechten, sowie politischen und sozialen Rechten die Bürgergesellschaft überhaupt erst entstehen lassen und ist ein wichtiger Antrieb für deren Weiterentwicklung. Zur Stagnation komme es immer dann, wenn Konflikte innerhalb der Gesellschaft oder die Notwendigkeit für deren Austragung nicht mehr erkannt werden.
Autonome Institutionen schaffen Anrecht und Angebot
Aus historischer Sicht ging es neben dem Streben nach mehr Rechten auch immer um ein größeres, vor allem wirtschaftliches, Angebot. Vor allem im Konflikt zwischen Kapital und Arbeit bildeten sich Interessengruppen heraus, die den Kampf institutionalisiert führten, damit aus individuellen Wahloptionen echte Lebenschancen werden konnten. Deren Autonomie hält Dahrendorf für unerlässlich. Das einstige Klassengefüge ist mittlerweile aufgeweicht und jedem wird der Zugang zu Bürgerrechten formal gewährt. Eintrittsbarrieren sind jetzt überwiegend monetärer Natur, sowie durch mangelnde Mobilität und Flexibilität begründet. Sie entstehen durch Ausgrenzung aufgrund von Andersartigkeit.
Neben autonomen Institutionen ist der Wille des Einzelnen zur Gestaltung des eigenen und des gesellschaftlichen Lebens ein wesentlicher Bestandteil der Bürgergesellschaft. Der Wille allein reicht aber nicht, wenn die Eintrittskarte für die Teilnahme und Teilhabe am Gesellschaftsspiel fehlt. Wiederum ist die Eintrittskarte nutzlos, wenn kein Spiel geboten wird. Garantiertes Anrecht und wirtschaftliches Angebot müssen somit in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das Nicaragua des Jahres 1986 bietet dafür ein anschauliches Beispiel: Das sandinistische Revolutionsregime war stolz darauf, das Überangebot für Wenige zugunsten eines Mangels für alle beseitigt zu haben.
Die formal hergestellte Bürgergesellschaft darf nicht durch faktische Barrieren durchzogen sein und gewährte Rechte sind nur wirksam, wenn man von ihnen auch Gebrauch macht. Sonst besteht die Gefahr, dass irgendwann sogar Grundrechte für überflüssig erachtet werden. Wenn der Einzelne faktische Begrenzung hinnimmt, obwohl sie formal nicht mehr existiert, bringt er damit langfristig alle und somit das Gesellschaftsgebilde insgesamt in Gefahr. Das geschieht vor allem dort, wo man sich über Jahrzehnte hinweg an institutionelle Interessenvertretung gewöhnt hat und sich in passiver Haltung einfach auf diese verlässt.
„Es geht bei der Bürgergesellschaft um das schöpferische Chaos der vielen, vor dem Zugriff des (Zentral-)Staates geschützten Organisationen und Institutionen. (…) Der Staat überlässt den Einzelnen breite Bereiche des Lebens, so dass diese sich weder für noch gegen dessen Institutionen entfalten, um am Ende gemeinsam mit diesen und mit der Marktwirtschaft Lebenschancen zu befördern.“
(Ralf Dahrendorf : "Der moderne soziale Konflikt“, 1992)
Das Auseinanderfallen der Mehrheitsgesellschaft begründet den modernen sozialen Konflikt
Das Zerbröckeln einer offenkundig illusionär gewordenen internationalen Ordnung habe die Länder der Welt ungeschützt den Winden einer direkten Ausübung von Macht ausgesetzt, so Dahrendorf. Jeder löst seine Probleme selbst. Deshalb war es auch nicht die internationale Staatengemeinschaft, die das südafrikanische Apartheidsregime stürzte, sondern das musste von innen heraus geschehen. Internationale Anrechtsgarantien verloren an Bedeutung, einzelstaatliches Eigeninteresse trat in den Mittelpunkt. Allen voran standen und stehen dabei die USA.
Es gibt nicht stetig mehr für eine stetig wachsende Bevölkerung zu verteilen. Dahrendorf meint, dieser Prozess habe in den 1970er Jahren begonnen, als die Wachstumseuphorie an Dynamik verloren hatte:
„Menschen hörten auf, von Regierungen viel zu erwarten. Sie schraubten ihre Erwartungen zurück. Der Großstaat wurde nicht demontiert, sondern von seinen Bürgern verlassen.“
(Ralf Dahrendorf : "Der moderne soziale Konflikt“, 1992)
Die in den 1980er und 1990er Jahren Sozialisierten sieht Dahrendorf aufgrund einer angespannten weltpolitischen Lage, fragwürdiger Wachstumsziele und instabiler
Sozialpolitik desillusioniert. Er verwendet dafür den Begriff „neue Unübersichtlichkeit“: Eine Funktionsüberladung des Staates und ein Ungleichgewicht zwischen Anrechten und
Angeboten.
Die Balance könne durch „eigene Zentren menschlicher Tätigkeit“ innerhalb der Bürgergesellschaft, die kulturelle Differenzen duldet und fördert, wieder hergestellt werden, so hoffte er. Ein Streben nach exklusiven Gesellschaften steht dem jedoch entgegen. Die Auflösung Jugoslawiens wäre hier als Beispiel anzuführen.
Gegen individuelle Bestrebungen, sich aufgrund enttäuschter Erwartungen und mangelnder Teilhabe aus der Gesellschaft zu verabschieden, nutzt auch ein ausgewogenes Verhältnis von Anrecht und Angebot nichts. Diese Menschen kommen im Gesellschaftsspiel einfach nicht zum Zug. Deshalb gibt es auch keinen Grund, sich an dessen Spielregeln zu halten. Neben der räumlichen Trennung vom Zugang zu Anrechten und Angeboten ist es ein Zustand der Lethargie und Resignation, der die Gesellschaft spaltet. Problematisch ist dabei, dass Institutionen kaum in der Lage sind, Einheit herzustellen. Wie soll man an die Gesellschaft glauben, wenn die Erfahrung etwas anderes gelehrt hat ?! Zudem kann es durchaus seinen Reiz haben, eine Gegenkultur zu entwickeln und nicht mehr dazugehören zu WOLLEN.
„In einem durchaus ernsten Sinn gilt die moralisch unerträgliche Feststellung, dass die Gesellschaft diese Menschen nicht
braucht. In der Mehrheitsklasse wünschen viele, die Unterklasse möge einfach von der Bildfläche verschwinden.“
(Ralf Dahrendorf : "Der moderne soziale Konflikt“, 1992)
Abwehrmechanismen verhindern Lernprozesse
Ausgrenzung statt Nutzung des Potentials verschiedenartiger Lebensmodelle führt dazu, dass wir nicht mehr voneinander lernen. Damit werden nicht nur individuelle Chancen verbaut, sondern in der Folge auch die Entwicklungsoptionen von Gesellschaften insgesamt deutlich eingeschränkt. Langfristig erreicht dieser Prozess alle gesellschaftlichen Teilbereiche, auch die „Mehrheitsklasse“. Hier steht die Angst vor denjenigen, die nicht dazugehören im Vordergrund: Die „Minderheitenklasse“ und die kulturell Anderen. Damit verliert sie nicht nur ihre Vorbildfunktion, sondern auch ihr Selbstvertrauen, was häufig in Protektionismus mündet.
Wer sich etablieren und die erlangte Position beibehalten kann, gerät in Konflikt mit denjenigen, denen diese Fähigkeit aufgrund von Eintrittsbarrieren verweigert wird, die dieses Können verloren haben oder das gar nicht wollen. Jeder kann in beide Richtungen jederzeit auf- bzw. absteigen. Es gibt keine Sicherheit, sondern es herrscht große Durchlässigkeit. So sieht der moderne soziale Konflikt aus. Er nimmt kein Ende, sofern Teilgesellschaften es vorziehen, exklusiv zu sein, bzw. zu bleiben. Das erzeugt weder ein Können, noch ein Wollen. Das schafft weder Perspektive, noch Orientierung. Da hilft auch kein Gleichgewicht von Anrecht und Angebot weiter.
© Katja Tropoja
Warum die Moral der Postmoderne nur im Chaos überlebt
© Katja Tropoja
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit war der Schlachtruf der Moderne.
Freiheit, Veschiedenheit, Toleranz ist die Waffenstillstandsformel der Postmoderne.“
(Zygmunt Bauman in: Moderne und Ambivalenz, 1991)
Soziale distanz fördert menschliche Grausamkeit
Die Moral in der Moderne schwindet in erster Linie durch unser vernunftgeleitetes und zugleich instrumentalisiertes Verhalten. Darin entfalten die moderne Zivilisation und der damit einher gehende technische Fortschrift ihr wahres mörderisches Potential. Der Grund dafür ist, dass menschliche Grausamkeit durch soziale Distanz erzeugt wird, wobei die persönliche Disposition zur Gewalt zweitrangig sei. So lautet die These des Soziologen und Philosophen Zygmunt Bauman, der einen Großteil seiner Arbeit der komplizierten Relation von Freiheit und Ordnung widmete und erklärte, warum Grausamkeit nicht die alleinige Ursache des Holocaust war.
Rationalisierung und Bürokratisierung vergrößern soziale Distanz
Soziale Distanz wächst, wo hochgradige Arbeitsteilung herrscht und wo es eine Aneinanderreihung einer Vielzahl von Entscheidungs- und Handlungsinstanzen gibt. Wo keine soziale Nähe ist, treten Menschen nicht mehr als Personen in Erscheinung, sondern werden als Gegenstand einer Handlung anonymisiert, die keiner wertenden Moral unterliegt. Moralisch legitimiert ist stattdessen, was rationalisierte und bürokratisierte Prozesse funktionieren lässt. Unmoralisch ist, was diese Prozesse bremst, sowie die Unterlassung dessen, was sie funktionieren lässt. Der Zivilisation und Fortschritt fördernde Zweck ist der moralische Indikator und heiligt jedes Mittel. Panoptische Institutionen instrumentalisieren einzelne Akteure als Funktionalitätsproduzenten und niemand muss persönlich Verantwortung für den anderen übernehmen, denn moralisch gut und wichtig ist allein loyales Verhalten gegenüber dem hierarchisch strukturierten rational-bürokratischen System.
Die Moderne hat ein separierendes Wesen
Sie trennt, was eigentlich zusammen gehört:
- Das eigenverantwortliche Handeln von der kollektiv gültigen Moral
- Glaube, Gewissen und Gefühl von der Handlung
- Handlungsmotive von den Konsequenzen des Handelns
Der Holocaust ist ein Resultat dieser modernen Entkopplung. Sein Zweck war kollektiv akzeptiert und moralisch legitimiert, weil Rationalisierung und Bürokratisierung
hervorragend funktionierten. Vor allem der hohe Grad an Arbeitsteilung hat in die Katastrophe geführt:
„Erst die rational bestimmte Welt der modernen Zivilisation macht den Holocaust möglich.“
(Zygmunt Bauman in: Dialektik der Ordnung, 1992).
Die Moderne drängt zur Herstellung von Ordnung durch Selektion
Ordnung ist ein Ziel, dass sich die Moderne selbst auferlegt hat. Sie erreicht es mit Hilfe von willkürlichen Selektionskriterien. Was mehrdeutig, ambivalent und natürlich ist, hat weder Sinn, noch Zweck. Was weder Sinn, noch Zweck hat, ist bedeutungslos und hat daher keine Daseinsberechtigung.
Das Streben nach Ordnung und die Beseitigung von Widersprüchlichkeiten rechtfertigt jede Maßnahme, die das natürliche Chaos beseitigen kann. Deshalb muss der Einzelne nicht prüfen, ob sein Verhalten durch Moralvorstellungen legitimiert ist. Besonders deutlich wird das in der Wissenschaft, wo zugunsten des Forschungsfortschritts fast alles erlaubt ist.
Modern ist, was gestaltet, verwaltet und technologisch optimiert werden kann. Damit steht die Natur in Opposition zu Humanität und Moralität:
„Der machtvolle Wille der Menschheit als „Herr des Universums“ und die Ausübung ihres alleinigen Rechts, Bedeutungen und Qualitätsmaßstäbe
festzulegen, machen die Objekte der Herrschaft und Gesetzgebung zu Natur.“
(Zygmunt Bauman in: Moderne und Ambivalenz, 1991).
Die Moderne selektiert Sieger von Verlierern und moralisch überlegen ist immer der Sieger. Von ihm könnte man erwarten, dass er einen moralischen Fortschritt bewirkt. Wie die Geschichte gezeigt hat, bleibt dieser aber regelmäßig aus, denn auch die „Siegermächte“ sind aus einer Kultur der zivilisatorischen Moderne mit ihren negativen Eigenschaften gewachsen.
Die Moderne lehnt das Fremde ab
Eine weitere Ordnungskategorie ist das Freund-Feind-Schema, ohne die moderne Gesellschaftung nicht vorstellbar ist. Der Fremde passt in dieses Schema jedoch nicht hinein, da er zunächst unbekannt und nicht einzuordnen ist:
„Tatsächlich ist der Fremde eine Person, die mit einer unheilbaren Krankheit, der multiplen Inkongruenz geschlagen ist. Der Fremde ist aus
diesem Grund das tödliche Gift der Moderne.“
(Zygmunt Bauman in: Moderne und Ambivalenz, 1991).
Wer sich dem Streben nach Ordnung nicht anpasst, wird als Bedrohung empfunden. Langfristig könnte der Fremde alle Ordnungskategorien oder sogar die moderne Weltordnung beseitigen, so die Befürchtung. Selbst wenn der Fremde sich an Regeln hält, verstößt er zumindest gegen das Ordnungskriterium der Unterscheidbarkeit, denn er wird erst durch soziale Nähe zum Fremden, vorher ist er gar nicht existent. Am sichersten ist es deshalb, dem Fremden erst gar nicht zu begegnen. Lässt sich das nicht vermeiden und kommt es aufgrund sozialer Nähe doch zu einer Begegnung mit ihm, dann ist die räumliche Trennung das erste Mittel der Wahl. Ist das nicht möglich, dann wird der Fremde als Präventivmaßnahme stigmatisiert, vorzugsweise und der Einfachheit halber aufgrund von äußeren Merkmalen. Ist der Effekt dieser Maßnahme ebenfalls unzureichend, dann wird er unter Androhung von Sanktionen aufgefordert, sich anzupassen. Selbst wenn ihm das gelingt, ist es unvermeidlich, dass er die bestehende Ordnung verändern wird, sobald er ein Teil dessen ist. Das zusätzliche Element verändert unweigerlich den aktuellen Status. Das ist in jedem System so.
Die Moderne kontrolliert zwanghaft den sozialen Raum
Gelingt die Assimilation des Fremden, dann ist das Ordnungssystem zwar nicht mehr so wie vorher, aber eine Bestätigung des Machtgefüges und der Dominanz der
assimilierenden Institutionen findet trotzdem statt. Gleichzeitig rechtfertigt sie erneut die bestehende Ordnung, der sogar die Anwesenheit von Fremden nicht schaden kann, sofern die Kontrolle
über den sozialen Raum gewährleistet ist. Die allgemeine Schulpflicht, die Ausrichtung des Werdegangs auf ein Erwerbsleben, die obligatorische Staatsangehörigkeit, etc. sind moderne Formen der
Sozialraumüberwachung.
In diesem Sinn ist der Nationalsozialismus eine weitere Ausprägungsform dieser Sozialraumüberwachung und der Holocaust ein Ausdruck des vernichtenden Potentials der modernen Zivilisation, sagt Bauman. Die Basis ist immer die gleiche: Das Streben nach der Definitionsmacht über duale Ordnungskategorien, die wertende Klassifizierung, die Entscheidungsbefugnis über gut und böse, richtig und falsch, lebenswert und lebensunwert, usw.
Bauman bezweifelt jedoch, dass sich der Holocaust als moderne Form des Völkermordes in der Postmoderne wiederholen könnte und zwar nicht, weil der postmoderne und individualisierte Mensch weniger grausam ist, sondern weil die postmoderne Gesellschaft ein dezentral organisiertes, hoch fragmentiertes und zersplittertes Gebilde ist. Darüber hinaus sinke die Sehnsucht nach der „guten Gesellschaft“ und der dafür notwendigen ideologischen Fundierung stetig.
Pluralismus und Individualisierung fördern Moral und Humanität
Ausschließlich im Pluralismus sieht Bauman den Schlüssel zu Gewissenhaftigkeit, Eigenverantwortlichkeit und somit zu moralischem Verhalten des Einzelnen. Die Postmoderne lehnt einen modernen Umgang mit der Moral ab und betont stattdessen die große Bedeutung der Gegensätzlichkeiten des Lebens. Die Postmoderne akzeptiert die Unklarheit, das Unvollständige, das Ungewisse, die Unsicherheit, das Unabgeschlossene, das Chaos. Der postmoderne Mensch legt sich nicht fest, hält sich Optionen offen und folgt seinem individuell in ihm angelegten moralischen Impuls:
„Die Postmoderne ist eine Aussicht auf Emanzipation des autonomen moralischen Selbst und die Rehabilitation seiner moralischen
Verantwortlichkeit; als eine Aussicht auf ein moralisches Selbst, das – ohne Fluchtgedanken – der inhärenten unheilbaren Ambivalenz ins Auge sieht, die jene Verantwortlichkeit mit sich bringt und
die bereits ihr Schicksal ist – immer noch darauf wartend, seiner Bestimmung zugeführt zu werden.“
(Zygmunt Bauman in: Postmoderne Ethik, 1995).
© Katja Tropoja
Flexibilität als kultureller Imperativ

© Katja Tropoja
Wem wir in gegenseitiger Abhängigkeit verbunden sind, dem begegnen wir verlässlich mit Loyalität, vielleicht sogar mit Vertrauen. Dafür brauchen wir eine gemeinsame Idee gemeinsamer Werte, die auch längerfristig Bestand hat und nicht bei der nächsten Gelegenheit wieder über Bord geworfen wird, je nach Interessenlage und individueller Wunschliste.
Die Ungeduld, Schnelligkeit und Beliebigkeit „flexibler“ Charaktere lässt dafür jedoch wenig Raum. Darüber hinaus sind wir von Menschen abhängig, die uns gar nicht brauchen. Wiederum müssen sich andere auf uns verlassen können, während für uns keineswegs die Notwendigkeit besteht, auf ihre Wünsche einzugehen, weil wir gut ohne sie auskommen.
- Wer kann uns als Person noch spiegeln und damit ein stabiles Selbstbild vermitteln?
- Wie sollen sich langfristig Charakter und Identität bilden, wenn soziale Bindungen flüchtig sind?
- Wo ist in einer flexibilisierten Gesellschaft die narrative Komponente zu finden?
- Was bedeutet das eigentlich für unsere Biographien?
- Was ist aus traditionellen Werten, wie die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, Treue, Loyalität, Verlässlichkeit, Beständigkeit und Ausdauer geworden?
- Lohnt es sich noch, langfristige Ziele zu formulieren und diese zu verfolgen, bis sich das gewünschte Ergebnis zeigt?
- Wird das überhaupt honoriert, wo sich doch ständig neue Wege erschließen und viele verschiedene Visionen existieren, die sich mühelos untereinander austauschen lassen?
- Macht es Sinn, Bedürfnisse aufzuschieben und in der Gegenwart Verzicht zu üben, zugunsten eines höheren, aber in weiter Ferne liegenden Ziels?
- Hat der Anspruch an unsere Flexibilität eine Priorität eingenommen, hinter der jede andere Tugend zurückbleibt?
- Woran sollen wir uns orientieren?
- Sind wir überhaupt noch in der Lage, nachfolgenden Generationen ein besseres Wertesystem zu vermitteln, wenn wir nicht in der Lage sind, dieses auch vorzuleben?
Flexibilität um jeden preis
Bereits vor zwanzig Jahren diagnostizierte der amerikanische Soziologe Richard Sennett eine Gesellschaft von ängstlichen, instabilen und verunsicherten Menschen, die zu einem großen Teil im Bewusstsein ihres Kontrollverlustes, der eigenen Hilflosigkeit und Handlungsunfähigkeit lebten, in der wenige profitieren und die Masse verliert. Er beschrieb 1998 in seinem Buch The Corrosion of Character den flexiblen Kapitalismus, die Ursachen für beschleunigte Arbeitsprozesse und wachsenden Leistungsdruck, sowie deren Folgen für die Lebenswelt und die Persönlichkeit des Einzelnen. Er tat dies vor dem Hintergrund der New Economy der 1990er Jahre. Diese hatte zu tiefgreifenden Veränderungen auf gesellschaftlicher, organisationaler und individueller Ebene geführt.
Als Unternehmen anfingen, sich für „ungeduldiges Kapital“ zu interessieren und spezialisierte Produktionstechnologien zu entwickeln, brach das stahlharte Gehäuse einer bürokratisierten und pyramidenartig hierarchisierten Arbeitswelt. Doch auch der flexible Kapitalismus ist keineswegs unbürokratisch. Kontrollinstanzen müssen die unbedingte Anpassung an Märkte gewährleisten. Ohne sie ist diese moderne Form des Kapitalismus nicht funktionsfähig.
Um hochspezialisiert zu produzieren wird der Markt hochgradig segmentiert und der Wertschöpfungsprozess ebenfalls in Einzelteile zerlegt. Diese treten miteinander in Konkurrenz, was zu Erfolgsdruck und Rivalität führt. Die Macht des flexiblen Kapitalismus potenziert sich aufgrund dieses mehrdimensionalen Gegeneinanders einzelner Einheiten. Sie ist gut organisiert, effizient, dabei weitestgehend unsichtbar, formlos und überaus subtil. „Moderne“ Organisationen müssen Macht deshalb nicht mehr offen auszuüben. Sie beobachten die Bereitschaft der Menschen zur Flexibilität. Wer sich ihr nicht unterwirft, ist draußen und wer sich fügt, wird zum „Drifter“, zu einem ziellos Dahintreibenden, einem Opfer der Flexibilisierung.
Vergangenheit, Routinen und Erfahrungen
Eine berechenbare Lebensweise basierte früher auf bürokratischen Strukturen. Das Leben war ein mehr oder weniger linearer Prozess, eine kontinuierliche Lebenserzählung mit „rotem Faden“ und in der Summe eine relativ runde Sache, ein kumulativer Erfolg. Langfristige Erwartungen, die Pflege von Gewohnheiten und Traditionen, sowie der Rückgriff auf Bewährtes schufen einen sinnvollen Erzählrahmen für das Leben.
Routinen und Gewohnheiten sind die Basis für ein innovatives Umfeld. Es ist deshalb nicht in jedem Fall produktiver und effizienter, Organisationen und Institutionen umzubauen oder ganz aufzulösen:
„Routine ist nicht geistlos. Sie lehrt uns, zu beschleunigen und zu verzögern, zu variieren, zu spielen und Neues zu entwickeln – wie ein Musiker lernt, beim Spielen eines Musikstücks die Zeit zu gestalten. Routinen sind schützenswerte Voraussetzungen für den menschlichen Charakter.“
(Richard Sennett)
Der flexible Kapitalismus setzt dagegen auf Okkassionalismus:
- Auf der Grundlage kurzfristiger Prognosen und in Reaktion auf Marktgegebenheiten werden Chancen ergriffen, alte Konzepte werden schnell verworfen.
- Jederzeit kann es neue Zielvorgaben geben, die tief in persönliche Lebenskonzepte eingreifen.
- Der Kontext von Ereignissen und von Resultaten aus früheren Entscheidungen ist so für alle Beteiligten nicht als großes Ganzes erkennbar.
- Es fehlen Bewusstsein und Gedächtnis für soziale und gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge.
- Der hohe Grad der Arbeitsteilung verursacht ein bindungsloses Gefüge der Teilsegmente, mangelnde Identifikation mit dem Arbeitsgegenstand und eine große Distanz zur Arbeitswelt.
Das macht es kaum noch möglich, die Umwelt und letztlich sich selbst zu lesen. Konstant bleibt aber die Forderung nach Flexibilität und Risikobereitschaft, jenseits entgegengesetzter, individueller Erfahrungen, die einzelne Akteure in der Vergangenheit gesammelt haben. Wer sich nicht bewegt, ist nicht erfolgreich. Plötzlich ist nicht das Ziel wichtig, sondern der Aufbruch dorthin. Veränderung wird zum kulturellen Imperativ, privates Scheitern als Folge von Bindungslosigkeit inklusive. Der flexible Kapitalismus legt dem Einzelnen in seinem Bindungsmangel nahe, sich dieses Scheitern selbst anzulasten. Das lenkt ab von der Ursache allen Übels: Eine globale Ökonomieelite übt moralischen und normativen Druck auf Wirtschaft und Politik und die gesamte Gesellschaft aus.
Erzählbarkeit und Lesbarkeit
Dem setzt Sennett eine Gemeinschaft der Betroffenen entgegen, die durch rituelles und kollektives Erzählen entsteht und sich selbst erhält. Sie ist Teil des modernen Kapitalismus und stellt sich den individuellen, konfliktreichen Biographien. Die beschriebenen Mangelerscheinungen lassen sich so teilweise reduzieren. Im Erzählen sind sie immerhin zu Mitgliedern einer Problemgemeinschaft geworden, übernehmen in gegenseitiger Akzeptanz Verantwortung und machen die wenigen lesbaren Formen des flexiblen Kapitalismus öffentlich sichtbar. Sie unterscheiden sich somit von Gemeinschaften im Sinne der Kommunitaristen, die das „oberflächliche Teilen gemeinsamer Werte“ propagieren und in Konflikten lediglich eine Bedrohung sehen, kritisiert Sennett.
Sennett meint, nur mit Hilfe sicherer und vertrauenswürdiger Institutionen, sowie einer an politischer Teilhabe interessierten und aktiven Öffentlichkeit, sei Besserung, d. h. ein Endes des „Dirft“ in Sicht:
"In der Moderne übernehmen die Menschen Verantwortung für ihr Leben, da sie es ganz als ihre Leistung betrachten. Aber wenn diese ethische Kultur der Moderne mit ihrer Semantik der persönlichen Verantwortlichkeit und des persönlichen Lebenserfolges in eine Gesellschaft ohne institutionellen Schutz übertragen wird, zeigt sich dort nicht Stolz auf das eigene Selbst, sondern eine Dialektik des Versagens inmitten von Wachstum."
(Richard Sennett: „Der neue Kapitalismus." In: Berliner Journal für Soziologie 8, 1998)
© Katja Tropoja
Mit seinem Buch „Die Kultur des neuen Kapitalismus“ (The Culture of the New Capitalism) setzte Sennett 2005 seine Ausführungen zum flexiblen Menschen im flexiblen Kapitalismus fort.
Die Prophezeiungen des Samuel P. Huntington: Wie gefährlich ist kulturelle Identität?
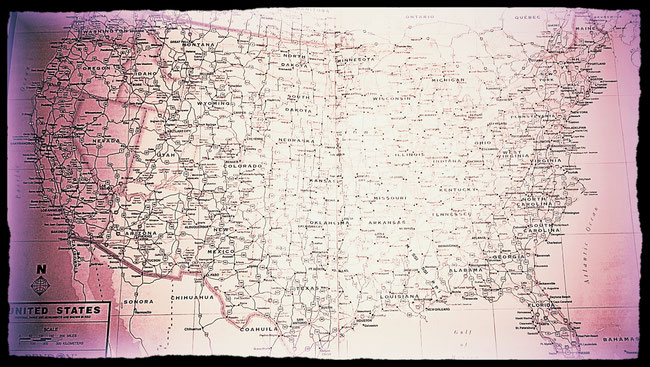
Der amerikanische Politikwissenschaftler und Regierungsberater in nationalen Sicherheitsfragen Samuel P. Huntington beschäftigte sich bereits in den 1960er Jahren intensiv mit nationalen Modernisierungs- und Demokratisierungsprozessen. 1993 erschien sein Artikel „The Clash of Civilizations?“ in der Fachzeitschrift Foreign Affairs. Dort warnte er davor, dass auf den Krieg der politischen Ideologien ein Krieg der Kulturen folgen würde.
Die Utopie einer unipolaren Gesellschaftsordnung
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Stimmung in den USA eher optimistisch, was die Zukunft betraf: Francis Fukuyama verkündete 1989 in seinem gleichnamigen Buch „das Ende der Geschichte“. Dabei orientierte er sich an der Geschichtsphilosophie Hegels und behauptete ernsthaft, nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes und dem Zusammenbruch der totalitären Systeme habe die Menschheit nun das letzte Stadium der politischen Geschichte erreicht, nämlich die universal-liberale Demokratie als unerschütterlich zementierte Regierungsform.
Dieser universalen Zivilisationsidee einer unipolaren Weltordnung, mit einem westlichen Menschenrechtsverständnis als Grundlage, folgten auch George Bush und Bill Clinton.
Ganz neu war diese Vision einer friedlichen Weltordnung allerdings nicht. Bereits Franklin D. Roosevelt hatte sie in schillernden Farben und lebhaften Bildern visualisiert. Harry S. Truman setzte dem Traum schließlich durch seine Doktrin vom 12. März 1947 und die anschließende „Containment“-Politik ein Ende. Dazu inspiriert hatte ihn der Historiker und Diplomat George F. Kennan, der ebenfalls einen Artikel in der Zeitschrift „Foreign Affairs“ publizierte, dessen Kernaussage lautete: „...the main element of any United States policy towards the Soviet Union must be a long-term, patient but firm and vigilant containment of Russian expansive tendencies (…).“ Auch wenn er, wie er später betonte, eher an politische und wirtschaftliche Methoden zur Eindämmung sowjetischen Einflusses gedacht hatte, wurde das Konzept in erster Linie militärisch interpretiert.
Es folgte der Kalte Krieg.
Kulturelle Identifizierung statt politische Ideologisierung
Innerhalb der bipolaren internationalen Weltordnung der folgenden vier Jahrzente ging es in erster Linie um die Frage nach der politisch ideologisierten Überzeugung. Man musste wissen, auf welcher Seite man stand. Die Seiten ließen sich aber beliebig wechseln, je nach aktueller Interessenlage. Davon hatten die blockfreien Staaten regelmäßig Gebrauch gemacht und so die USA und die Sowietunion gegeneinander ausgespielt.
Mit der eigenen kulturellen Identität funktioniert das nicht so einfach. Seit Beginn der 1990er Jahre rückte sie in den Vordergrund und Huntington erkannte darin den künftig wichtigsten Konfliktherd in den internationalen Beziehungen. Sie sei von existentieller und herausragender Bedeutung, denn die Frage „Was bin ich?“ ist sehr viel substantieller, unmittelbarer und tiefgreifender als die Frage nach einer politischen Ausrichtung. Huntington sah deshalb weitaus fundamentalere und gewalttätigere Konflikte voraus, als diejenigen, die man bis dahin kannte.
Keine Verwestlichung durch Modernisierung
Die politischen und wirtschaftlichen Eliten hatten in den 1990er Jahren überwiegend die gleiche Erwartungshaltung:
"Der wirtschaftliche Erfolg und technologische Fortschritt in den Schwellenländern wird mit der Übernahme westlicher Werte verbunden sein und es wird einen Angleich in Richtung
westliche Weltzivilisation geben."
Huntington hielt das für illusorisch. Stattdessen erwartete er einen „cultural backlash“:
„… non-Western societies have seen a return to indigenous cultures. It often takes a religious form… .” (in: Foreign Affairs, Ausgabe 75, 1996: “The West: Unique. Not Universal”).
Er sollte Recht behalten, denn innerhalb der „Schurkenstaaten“ erfreuten sich die Machthaber wieder steigender Beliebtheit in der eigenen Bevölkerung und wo demokratische Wahlen ermöglicht wurden, konnten sich autoritäre Machtstrukturen etablieren.
Materielle Modernisierung und “Verwestlichung” bedingen einander nicht. Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit hatten sich bereits im England der Vormoderne etabliert. Staat und Kirche waren schon getrennt, als der Westen von der Moderne noch weit entfernt war. Demokratie gab es schon im antiken Griechenland. Auch freie Märkte sind keine Erfindung der Moderne. Die Modernisierung muslimischer Gesellschaften hat diese nicht verwestlicht. Im Gegenteil: Moderne junge Menschen vertreten einen fundamentalen Islamismus. Seit mehr als vierzig Jahren sind dort über 20 % der Bevölkerung zwischen 15 und 24 Jahre jung. Das wäre an sich kein Problem, wäre Jugendlichkeit nicht traditionell ein Indiz für gesellschaftliche Destabilisierung und revolutionäres Verhalten. Die europäische Geschichte ist dafür beispielhaft:
Die Studentenbewegung am Ende der 1960er Jahre und der Terror der Roten Armee Fraktion, rechter Terrorismus durch den Nationalsozialistischen Untergrund, französische Revolution, usw. Das Rekrutieren für solche Zwecke gelingt immer dort, wo gesellschaftliche Verhältnisse prekär sind und wo einer Vielzahl junger Menschen eine Aussicht auf Identitätsfindung und Machtausübung gegeben werden kann. Im Nationalsozialismus ist der studentische Geheimbund Weiße Rose wahrscheinlich auch wegen des Fehlens dieser Voraussetzungen gescheitert.
Was Huntington voraussagte
Huntington prophezeite 1993 für die folgenden dreißig Jahre eine Welle des internationalen Terrorismus, starke Migrationswellen und blutige Grenzkriege zwischen Islam und „Ungläubigkeit“, das heißt dem unreligiösen, moralisch verwerflichen und dekadenten Lebensstil in den westlichen Gesellschaften. Diesem neuen Islam maß Huntington die gleiche Bedeutung bei, wie einst Max Weber der protestantischen Ethik in den USA und in Europa.
Auf äußerst turbulente Szenarien in den internationalen Beziehungen müsse man sich vorbereiten, so Huntington. Die USA würden sich weiterhin an Kriegen beteiligen und sich dort einmischen, wo es langfristig nur Verlierer geben könne. Militärische Überlegenheit und pseudo-moralisches Auftreten werden die USA zum „hollow hegemon“ machen, schrieb Huntington in einem weiteren Artikel in der Foreign Affairs, Ausgabe 78, 1999: „The Lonely Superpower“.
Die Nato-Mitgliedschaften Griechenlands und der Türkei solle man überdenken, da diese sich voraussichtlich mehr und mehr auf ihre „natürlichen“ kulturellen Verbündeten – d. h. auf ihre orthodoxen und islamischen Kernländer - zubewegen würden.
Misslinge die Assimilation der Einwanderer an die Kultur des Westens vollständig, dann gerieten die USA, Frankreich und Deutschland in Gefahr, zu kulturell zerrissenen, damit innenpolitisch schwachen und international handlungsunfähigen Staaten zu werden.
Die USA und Europa müssten den „konfliktstiftenden Sirenengesängen des Multikulturalismus“ eine Absage erteilen und den identitären Bezug zu ihrem „europäisch-jüdisch-christlichen Erbe" wieder intensivieren.
Huntingtons politisches Maßnahmenprogramm
- Die USA müssen sich in ihrer Außenpolitik von ihrem Menschenrechtsidealismus lösen, da dieser nicht in die Praxis umsetzbar ist.
- Die USA sollen sich ihren eigenen machtpolitischen Interessen zuwenden.
- Die USA müssen die transatlantischen Beziehungen vertiefen und mit Europa noch enger zusammenrücken als bisher.
- Die NATO-Osterweiterung wird die transatlantischen Verteidigungsstrukturen fördern und Identität und Machtressourcen des westlichen Kulturkreises festigen.
- Das „westliche Erbe“ muss bewahrt werden.
- Die USA und Europa müssen sich als Teil einer umfassenden westlichen Kultur erneuern.
Alle US-Präsidenten bis Anfang der 1990er Jahre waren der Meinung, dass die Förderung der nationalen Einheit und nicht die multikulturelle Verschiedenheit Erfolg und Wohlstand garantieren können. Clinton und Obama relativierten diese Aussage und wichen etwas vom Kurs ab.
Trump dagegen fürchtet offenbar, was schon Huntington als größte Bedrohung für die kulturelle Identität des Westens ansah: Die Multikulturalisten. Ob er sich an Huntingtons Maßnahmenkatalog halten wird, bleibt abzuwarten.
© Katja Tropoja







